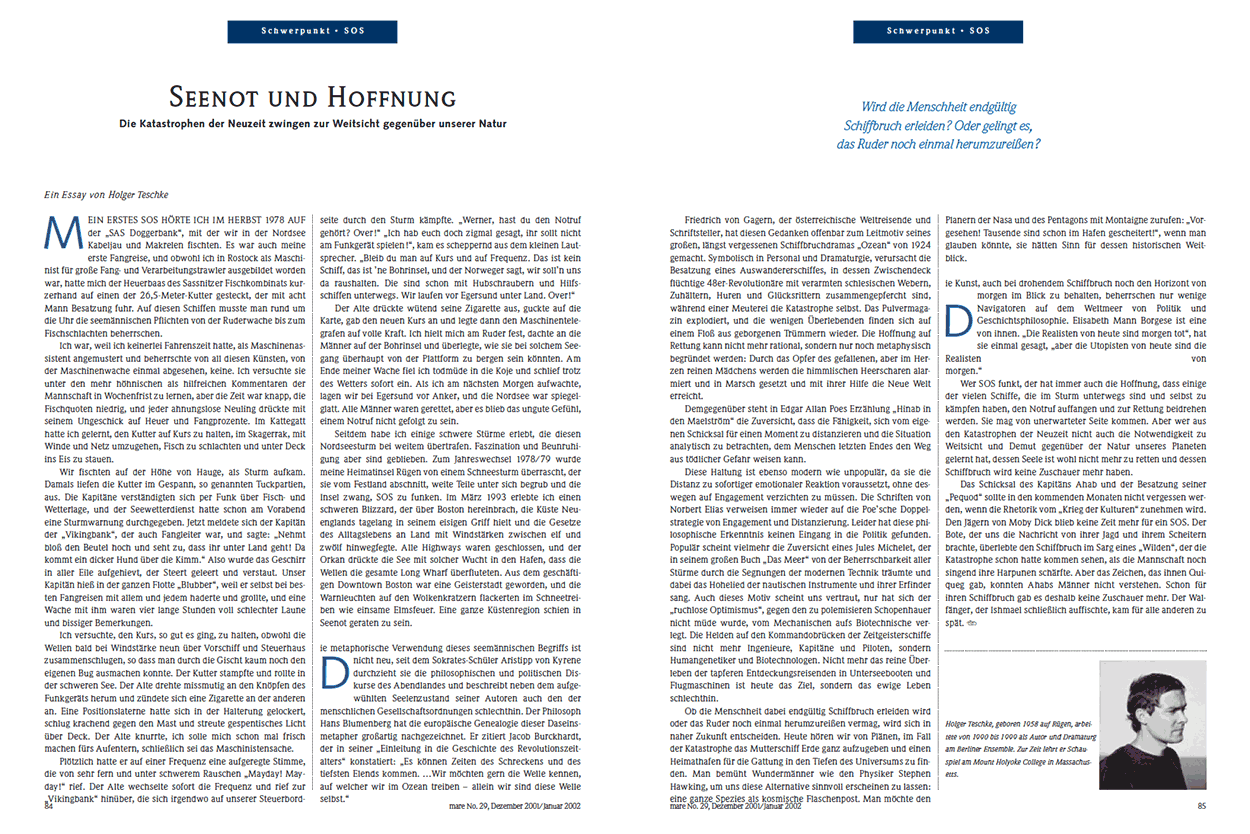Seenot und Hoffnung
Mein erstes SOS hörte ich im Herbst 1978 auf der „SAS Doggerbank“, mit der wir in der Nordsee Kabeljau und Makrelen fischten. Es war auch meine erste Fangreise, und obwohl ich in Rostock als Maschinist für große Fang- und Verarbeitungstrawler ausgebildet worden war, hatte mich der Heuerbaas des Sassnitzer Fischkombinats kurzerhand auf einen der 26,5-Meter-Kutter gesteckt, der mit acht Mann Besatzung fuhr. Auf diesen Schiffen musste man rund um die Uhr die seemännischen Pflichten von der Ruderwache bis zum Fischschlachten beherrschen.
Ich war, weil ich keinerlei Fahrenszeit hatte, als Maschinenassistent angemustert und beherrschte von all diesen Künsten, von der Maschinenwache einmal abgesehen, keine. Ich versuchte sie unter den mehr höhnischen als hilfreichen Kommentaren der Mannschaft in Wochenfrist zu lernen, aber die Zeit war knapp, die Fischquoten niedrig, und jeder ahnungslose Neuling drückte mit seinem Ungeschick auf Heuer und Fangprozente. Im Kattegatt hatte ich gelernt, den Kutter auf Kurs zu halten, im Skagerrak, mit Winde und Netz umzugehen, Fisch zu schlachten und unter Deck ins Eis zu stauen.
Wir fischten auf der Höhe von Hauge, als Sturm aufkam. Damals liefen die Kutter im Gespann, so genannten Tuckpartien, aus. Die Kapitäne verständigten sich per Funk über Fisch- und Wetterlage, und der Seewetterdienst hatte schon am Vorabend eine Sturmwarnung durchgegeben. Jetzt meldete sich der Kapitän der „Vikingbank“, der auch Fangleiter war, und sagte: „Nehmt bloß den Beutel hoch und seht zu, dass ihr unter Land geht! Da kommt ein dicker Hund über die Kimm.“ Also wurde das Geschirr in aller Eile aufgehievt, der Steert geleert und verstaut. Unser Kapitän hieß in der ganzen Flotte „Blubber“, weil er selbst bei besten Fangreisen mit allem und jedem haderte und grollte, und eine Wache mit ihm waren vier lange Stunden voll schlechter Laune und bissiger Bemerkungen.
Ich versuchte, den Kurs, so gut es ging, zu halten, obwohl die Wellen bald bei Windstärke neun über Vorschiff und Steuerhaus zusammenschlugen, so dass man durch die Gischt kaum noch den eigenen Bug ausmachen konnte. Der Kutter stampfte und rollte in der schweren See. Der Alte drehte missmutig an den Knöpfen des Funkgeräts herum und zündete sich eine Zigarette an der anderen an. Eine Positionslaterne hatte sich in der Halterung gelockert, schlug krachend gegen den Mast und streute gespentisches Licht über Deck. Der Alte knurrte, ich solle mich schon mal frisch machen fürs Aufentern, schließlich sei das Maschinistensache.
Plötzlich hatte er auf einer Frequenz eine aufgeregte Stimme, die von sehr fern und unter schwerem Rauschen „Mayday! Mayday!“ rief. Der Alte wechselte sofort die Frequenz und rief zur „Vikingbank“ hinüber, die sich irgendwo auf unserer Steuerbordseite durch den Sturm kämpfte. „Werner, hast du den Notruf gehört? Over!“ „Ich hab euch doch zigmal gesagt, ihr sollt nicht am Funkgerät spielen!“, kam es scheppernd aus dem kleinen Lautsprecher. „Bleib du man auf Kurs und auf Frequenz. Das ist kein Schiff, das ist ’ne Bohrinsel, und der Norweger sagt, wir soll’n uns da raushalten. Die sind schon mit Hubschraubern und Hilfsschiffen unterwegs. Wir laufen vor Egersund unter Land. Over!“
Der Alte drückte wütend seine Zigarette aus, guckte auf die Karte, gab den neuen Kurs an und legte dann den Maschinentelegrafen auf volle Kraft. Ich hielt mich am Ruder fest, dachte an die Männer auf der Bohrinsel und überlegte, wie sie bei solchem Seegang überhaupt von der Plattform zu bergen sein könnten. Am Ende meiner Wache fiel ich todmüde in die Koje und schlief trotz des Wetters sofort ein. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, lagen wir bei Egersund vor Anker, und die Nordsee war spiegelglatt. Alle Männer waren gerettet, aber es blieb das ungute Gefühl, einem Notruf nicht gefolgt zu sein.
Seitdem habe ich einige schwere Stürme erlebt, die diesen Nordseesturm bei weitem übertrafen. Faszination und Beunruhigung aber sind geblieben. Zum Jahreswechsel 1978/79 wurde meine Heimatinsel Rügen von einem Schneesturm überrascht, der sie vom Festland abschnitt, weite Teile unter sich begrub und die Insel zwang, SOS zu funken. Im März 1993 erlebte ich einen schweren Blizzard, der über Boston hereinbrach, die Küste Neuenglands tagelang in seinem eisigen Griff hielt und die Gesetze des Alltagslebens an Land mit Windstärken zwischen elf und zwölf hinwegfegte. Alle Highways waren geschlossen, und der Orkan drückte die See mit solcher Wucht in den Hafen, dass die Wellen die gesamte Long Wharf überfluteten. Aus dem geschäftigen Downtown Boston war eine Geisterstadt geworden, und die Warnleuchten auf den Wolkenkratzern flackerten im Schneetreiben wie einsame Elmsfeuer. Eine ganze Küstenregion schien in Seenot geraten zu sein.
Die metaphorische Verwendung dieses seemännischen Begriffs ist nicht neu, seit dem Sokrates-Schüler Aristipp von Kyrene durchzieht sie die philosophischen und politischen Diskurse des Abendlandes und beschreibt neben dem aufgewühlten Seelenzustand seiner Autoren auch den der menschlichen Gesellschaftsordnungen schlechthin. Der Philosoph Hans Blumenberg hat die europäische Genealogie dieser Daseinsmetapher großartig nachgezeichnet. Er zitiert Jacob Burckhardt, der in seiner „Einleitung in die Geschichte des Revolutionszeitalters“ konstatiert: „Es können Zeiten des Schreckens und des tiefsten Elends kommen. ...Wir möchten gern die Welle kennen, auf welcher wir im Ozean treiben – allein wir sind diese Welle selbst.“
Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 29. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.
Holger Teschke, geboren 1958 auf Rügen, arbeitete von 1990 bis 1999 als Autor und Dramaturg am Berliner Ensemble. Zur Zeit lehrt er Schauspiel am Mount Holyoke College in Massachusetts.
| Vita | Holger Teschke, geboren 1958 auf Rügen, arbeitete von 1990 bis 1999 als Autor und Dramaturg am Berliner Ensemble. Zur Zeit lehrt er Schauspiel am Mount Holyoke College in Massachusetts. |
|---|---|
| Person | Ein Essay von Holger Teschke |
| Vita | Holger Teschke, geboren 1958 auf Rügen, arbeitete von 1990 bis 1999 als Autor und Dramaturg am Berliner Ensemble. Zur Zeit lehrt er Schauspiel am Mount Holyoke College in Massachusetts. |
| Person | Ein Essay von Holger Teschke |