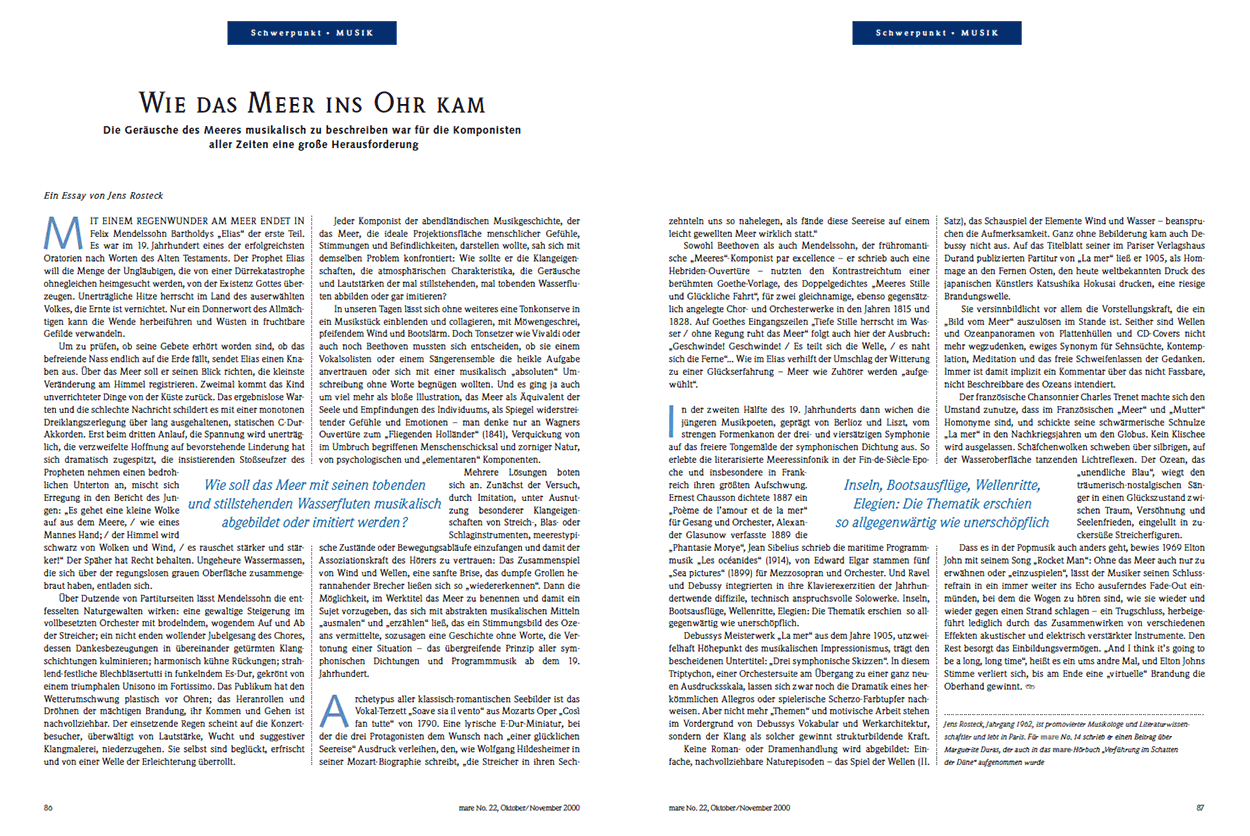Wie das Meer ins Ohr kam
Mit einem Regenwunder am Meer endet in Felix Mendelssohn Bartholdys „Elias" der erste Teil. Es war im 19. Jahrhundert eines der erfolgreichsten Oratorien nach Worten des Alten Testaments. Der Prophet Elias will die Menge der Ungläubigen, die von einer Dürrekatastrophe ohnegleichen heimgesucht werden, von der Existenz Gottes überzeugen. Unerträgliche Hitze herrscht im Land des auserwählten Volkes, die Ernte ist vernichtet. Nur ein Donnerwort des Allmächtigen kann die Wende herbeiführen und Wüsten in fruchtbare Gefilde verwandeln.
Um zu prüfen, ob seine Gebete erhört worden sind, ob das befreiende Nass endlich auf die Erde fällt, sendet Elias einen Knaben aus. Über das Meer soll er seinen Blick richten, die kleinste Veränderung am Himmel registrieren. Zweimal kommt das Kind unverrichteter Dinge von der Küste zurück. Das ergebnislose Warten und die schlechte Nachricht schildert es mit einer monotonen Dreiklangszerlegung über lang ausgehaltenen, statischen C-Dur-Akkorden. Erst beim dritten Anlauf, die Spannung wird unerträglich, die verzweifelte Hoffnung auf bevorstehende Linderung hat sich dramatisch zugespitzt, die insistierenden Stoßseufzer des Propheten nehmen einen bedrohlichen Unterton an, mischt sich Erregung in den Bericht des Jungen: „Es gehet eine kleine Wolke auf aus dem Meere, / wie eines Mannes Hand; / der Himmel wird schwarz von Wolken und Wind, / es rauschet stärker und stärker!" Der Späher hat Recht behalten. Ungeheure Wassermassen, die sich über der regungslosen grauen Oberfläche zusammengebraut haben, entladen sich.
Über Dutzende von Partiturseiten lässt Mendelssohn die entfesselten Naturgewalten wirken: eine gewaltige Steigerung im vollbesetzten Orchester mit brodelndem, wogendem Auf und Ab der Streicher; ein nicht enden wollender Jubelgesang des Chores, dessen Dankesbezeugungen in übereinander getürmten Klangschichtungen kulminieren; harmonisch kühne Rückungen; strahlend-festliche Blechbläsertutti in funkelndem Es-Dur, gekrönt von einem triumphalen Unisono im Fortissimo. Das Publikum hat den Wetterumschwung plastisch vor Ohren; das Heranrollen und Dröhnen der mächtigen Brandung, ihr Kommen und Gehen ist nachvollziehbar. Der einsetzende Regen scheint auf die Konzertbesucher, überwältigt von Lautstärke, Wucht und suggestiver Klangmalerei, niederzugehen. Sie selbst sind beglückt, erfrischt und von einer Welle der Erleichterung überrollt.
Jeder Komponist der abendländischen Musikgeschichte, der das Meer, die ideale Projektionsfläche menschlicher Gefühle, Stimmungen und Befindlichkeiten, darstellen wollte, sah sich mit demselben Problem konfrontiert: Wie sollte er die Klangeigenschaften, die atmosphärischen Charakteristika, die Geräusche und Lautstärken der mal stillstehenden, mal tobenden Wasserfluten abbilden oder gar imitieren?
In unseren Tagen lässt sich ohne weiteres eine Tonkonserve in ein Musikstück einblenden und collagieren, mit Möwengeschrei, pfeifendem Wind und Bootslärm. Doch Tonsetzer wie Vivaldi oder auch noch Beethoven mussten sich entscheiden, ob sie einem Vokalsolisten oder einem Sängerensemble die heikle Aufgabe anvertrauen oder sich mit einer musikalisch „absoluten" Umschreibung ohne Worte begnügen wollten. Und es ging ja auch um viel mehr als bloße Illustration, das Meer als Äquivalent der Seele und Empfindungen des Individuums, als Spiegel widerstreitender Gefühle und Emotionen - man denke nur an Wagners Ouvertüre zum „Fliegenden Holländer" (1841), Verquickung von im Umbruch begriffenen Menschenschicksal und zorniger Natur, von psychologischen und „elementaren" Komponenten.
Mehrere Lösungen boten sich an. Zunächst der Versuch, durch Imitation, unter Ausnutzung besonderer Klangeigenschaften von Streich-, Blas- oder Schlaginstrumenten, meerestypische Zustände oder Bewegungsabläufe einzufangen und damit der Assoziationskraft des Hörers zu vertrauen: Das Zusammenspiel von Wind und Wellen, eine sanfte Brise, das dumpfe Grollen herannahender Brecher ließen sich so „wiedererkennen". Dann die Möglichkeit, im Werktitel das Meer zu benennen und damit ein Sujet vorzugeben, das sich mit abstrakten musikalischen Mitteln „ausmalen" und „erzählen" ließ, das ein Stimmungsbild des Ozeans vermittelte, sozusagen eine Geschichte ohne Worte, die Vertonung einer Situation - das übergreifende Prinzip aller symphonischen Dichtungen und Programmmusik ab dem 19. Jahrhundert.
Archetypus aller klassisch-romantischen Seebilder ist das Vokal-Terzett „Soave sia il vento" aus Mozarts Oper „Così fan tutte" von 1790. Eine lyrische E-Dur-Miniatur, bei der die drei Protagonisten dem Wunsch nach „einer glücklichen Seereise" Ausdruck verleihen, den, wie Wolfgang Hildesheimer in seiner Mozart-Biographie schreibt, „die Streicher in ihren Sechzehnteln uns so nahelegen, als fände diese Seereise auf einem leicht gewellten Meer wirklich statt."
Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 22. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.
Jens Rosteck, Jahrgang 1962, ist promovierter Musikologe und Literaturwissenschaftler und lebt in Paris. Für mare No. 14 schrieb er einen Beitrag über Marguerite Duras, der auch in das mare-Hörbuch Verführung im Schatten der Düne aufgenommen wurde
| Vita | Jens Rosteck, Jahrgang 1962, ist promovierter Musikologe und Literaturwissenschaftler und lebt in Paris. Für mare No. 14 schrieb er einen Beitrag über Marguerite Duras, der auch in das mare-Hörbuch Verführung im Schatten der Düne aufgenommen wurde |
|---|---|
| Person | Ein Essay von Jens Rosteck |
| Vita | Jens Rosteck, Jahrgang 1962, ist promovierter Musikologe und Literaturwissenschaftler und lebt in Paris. Für mare No. 14 schrieb er einen Beitrag über Marguerite Duras, der auch in das mare-Hörbuch Verführung im Schatten der Düne aufgenommen wurde |
| Person | Ein Essay von Jens Rosteck |