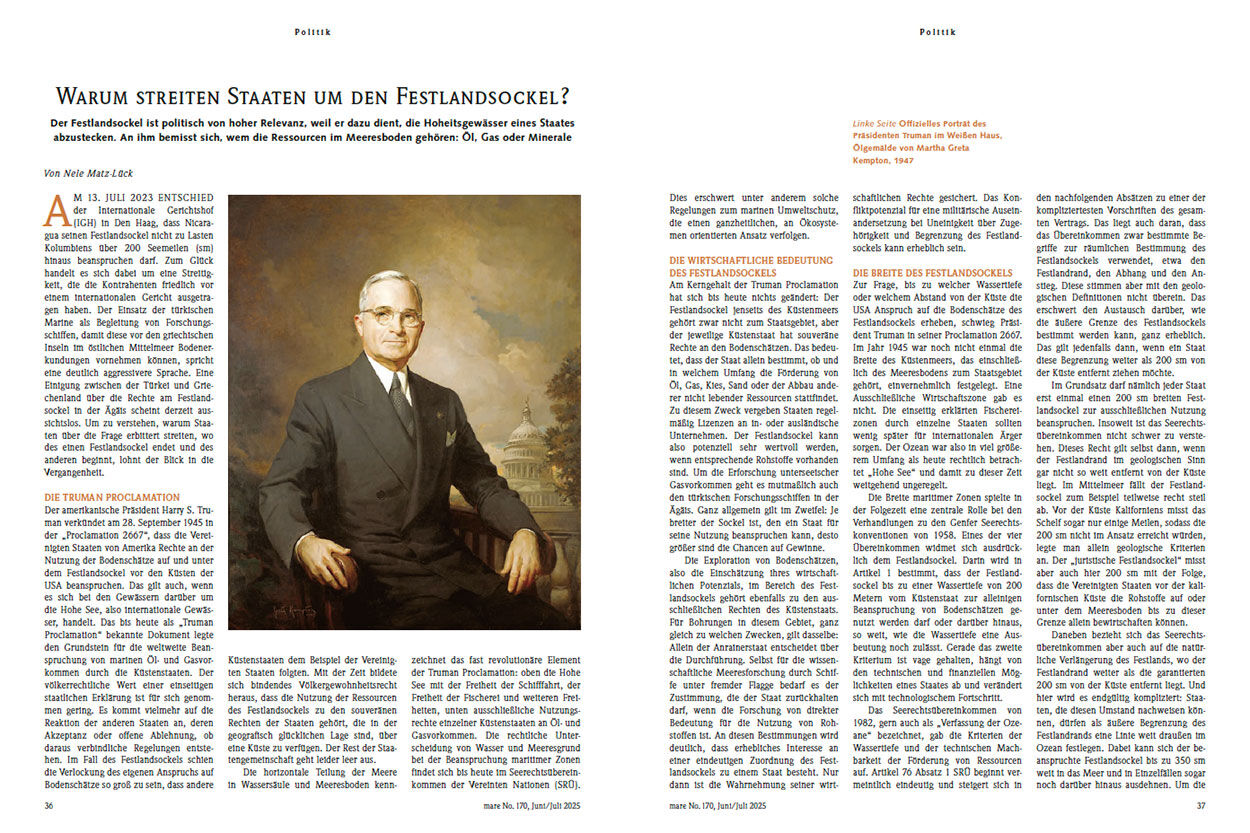Warum streiten Staaten um den Festlandsockel?
Am 13. Juli 2023 entschied der Internationale Gerichtshof (IGH) in Den Haag, dass Nicaragua seinen Festlandsockel nicht zu Lasten Kolumbiens über 200 Seemeilen (sm) hinaus beanspruchen darf. Zum Glück handelt es sich dabei um eine Streitigkeit, die die Kontrahenten friedlich vor einem internationalen Gericht ausgetragen haben. Der Einsatz der türkischen Marine als Begleitung von Forschungsschiffen, damit diese vor den griechischen Inseln im östlichen Mittelmeer Bodenerkundungen vornehmen können, spricht eine deutlich aggressivere Sprache. Eine Einigung zwischen der Türkei und Griechenland über die Rechte am Festlandsockel in der Ägäis scheint derzeit aussichtslos. Um zu verstehen, warum Staaten über die Frage erbittert streiten, wo des einen Festlandsockel endet und des anderen beginnt, lohnt der Blick in die Vergangenheit.
Die Truman Proclamation
Der amerikanische Präsident Harry S. Truman verkündet am 28. September 1945 in der „Proclamation 2667“, dass die Vereinigten Staaten von Amerika Rechte an der Nutzung der Bodenschätze auf und unter dem Festlandsockel vor den Küsten der USA beanspruchen. Das gilt auch, wenn es sich bei den Gewässern darüber um die Hohe See, also internationale Gewässer, handelt. Das bis heute als „Truman Proclamation“ bekannte Dokument legte den Grundstein für die weltweite Beanspruchung von marinen Öl- und Gasvorkommen durch die Küstenstaaten. Der völkerrechtliche Wert einer einseitigen staatlichen Erklärung ist für sich genommen gering. Es kommt vielmehr auf die Reaktion der anderen Staaten an, deren Akzeptanz oder offene Ablehnung, ob daraus verbindliche Regelungen entstehen. Im Fall des Festlandsockels schien die Verlockung des eigenen Anspruchs auf Bodenschätze so groß zu sein, dass andere Küstenstaaten dem Beispiel der Vereinigten Staaten folgten. Mit der Zeit bildete sich bindendes Völkergewohnheitsrecht heraus, dass die Nutzung der Ressourcen des Festlandsockels zu den souveränen Rechten der Staaten gehört, die in der geografisch glücklichen Lage sind, über eine Küste zu verfügen. Der Rest der Staatengemeinschaft geht leider leer aus.
Die horizontale Teilung der Meere
in Wassersäule und Meeresboden kennzeichnet das fast revolutionäre Element der Truman Proclamation: oben die Hohe See mit der Freiheit der Schifffahrt, der Freiheit der Fischerei und weiteren Freiheiten, unten ausschließliche Nutzungsrechte einzelner Küstenstaaten an Öl- und Gasvorkommen. Die rechtliche Unterscheidung von Wasser und Meeresgrund bei der Beanspruchung maritimer Zonen findet sich bis heute im Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen (SRÜ). Dies erschwert unter anderem solche Regelungen zum marinen Umweltschutz, die einen ganzheitlichen, an Ökosystemen orientierten Ansatz verfolgen.
Die wirtschaftliche Bedeutung des Festlandsockels
Am Kerngehalt der Truman Proclamation hat sich bis heute nichts geändert: Der Festlandsockel jenseits des Küstenmeers gehört zwar nicht zum Staatsgebiet, aber der jeweilige Küstenstaat hat souveräne Rechte an den Bodenschätzen. Das bedeutet, dass der Staat allein bestimmt, ob und in welchem Umfang die Förderung von Öl, Gas, Kies, Sand oder der Abbau anderer nicht lebender Ressourcen stattfindet. Zu diesem Zweck vergeben Staaten regelmäßig Lizenzen an in- oder ausländische Unternehmen. Der Festlandsockel kann also potenziell sehr wertvoll werden, wenn entsprechende Rohstoffe vorhanden sind. Um die Erforschung unterseeischer Gasvorkommen geht es mutmaßlich auch den türkischen Forschungsschiffen in der Ägäis. Ganz allgemein gilt im Zweifel: Je breiter der Sockel ist, den ein Staat für seine Nutzung beanspruchen kann, desto größer sind die Chancen auf Gewinne.
Die Exploration von Bodenschätzen, also die Einschätzung ihres wirtschaftlichen Potenzials, im Bereich des Festlandsockels gehört ebenfalls zu den ausschließlichen Rechten des Küstenstaats. Für Bohrungen in diesem Gebiet, ganz gleich zu welchen Zwecken, gilt dasselbe: Allein der Anrainerstaat entscheidet über die Durchführung. Selbst für die wissenschaftliche Meeresforschung durch Schiffe unter fremder Flagge bedarf es der Zustimmung, die der Staat zurückhalten darf, wenn die Forschung von direkter Bedeutung für die Nutzung von Rohstoffen ist. An diesen Bestimmungen wird deutlich, dass erhebliches Interesse an einer eindeutigen Zuordnung des Festlandsockels zu einem Staat besteht. Nur dann ist die Wahrnehmung seiner wirtschaftlichen Rechte gesichert. Das Konfliktpotenzial für eine militärische Auseinandersetzung bei Uneinigkeit über Zugehörigkeit und Begrenzung des Festlandsockels kann erheblich sein.
Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 170. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.
Nele Matz-Lück, Jahrgang 1973, ist Professorin für Seerecht und lehrt an an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.
| Lieferstatus | Lieferbar |
|---|---|
| Vita | Nele Matz-Lück, Jahrgang 1973, ist Professorin für Seerecht und lehrt an an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. |
| Person | Von Nele Matz-Lück |
| Lieferstatus | Lieferbar |
| Vita | Nele Matz-Lück, Jahrgang 1973, ist Professorin für Seerecht und lehrt an an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. |
| Person | Von Nele Matz-Lück |