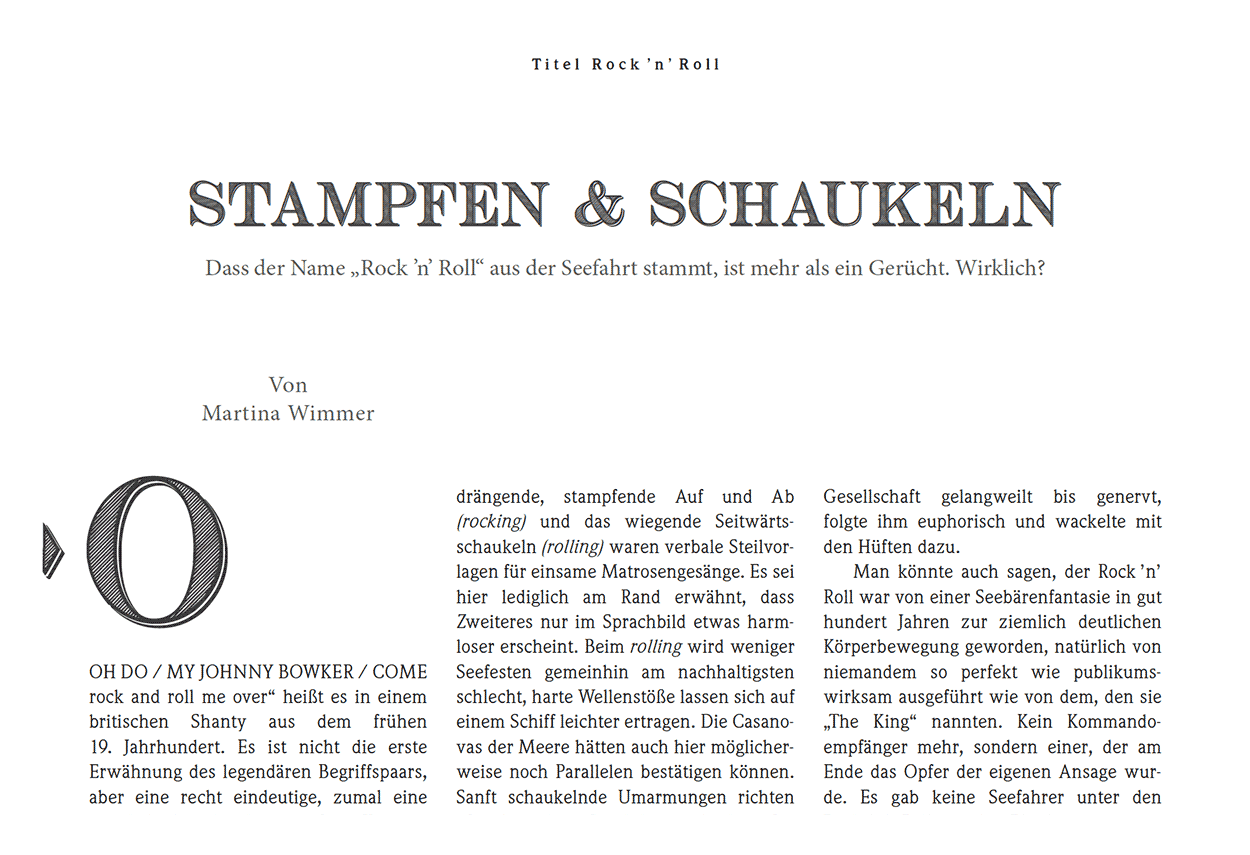Stampfen & Schaukeln
„Oh do / my Johnny Bowker / come rock and roll me over“ heißt es in einem britischen Shanty aus dem frühen 19. Jahrhundert. Es ist nicht die erste Erwähnung des legendären Begriffspaars, aber eine recht eindeutige, zumal eine musikalische, die die verrufene Karriere des Rock ’n’ Roll in seiner späteren Bedeutung recht passend einleitet. Spezialisten sortieren Bowker unter die sweating-up-chants, Lieder für kurze, heftige Bewegungen, bei denen die Männer ordentlich ins Schwitzen gerieten.
Letztlich kommt es eben bei vielem auf den richtigen Rhythmus an. Und nicht notwendigerweise auf liebliche Harmonien. Das gilt fürs Segelsetzen genauso wie für Sex. Der Rhythmus jedenfalls war es, den die Seeleute brauchten, um an Bord ihre Kräfte zu mobilisieren. Der Beat, die Schlagzahl, das gesungene Kommando, schon damals haben die Kerle dabei offenbar nicht an die Schwere der Arbeit gedacht, sondern lieber an die Leichtigkeit des Seins und ihre Seemannsbräute an Land.
Rocking and rolling, das taten Schiffe seit je in der Sprache der Seefahrernation, Schiffe, die nebenbei im Englischen schon immer weiblich waren. Und die Variationen im Wechselspiel von Wellen und Bootskörpern eigneten sich bestens für zotige Allegorien, die immer mitklangen, wenn Schiffe so wild auf dem Meer tanzten wie später die entfesselte amerikanische Jugend: Das beharrlich vorwärts drängende, stampfende Auf und Ab (rocking) und das wiegende Seitwärtsschaukeln (rolling) waren verbale Steilvorlagen für einsame Matrosengesänge. Es sei hier lediglich am Rand erwähnt, dass Zweiteres nur im Sprachbild etwas harmloser erscheint. Beim rolling wird weniger Seefesten gemeinhin am nachhaltigsten schlecht, harte Wellenstöße lassen sich auf einem Schiff leichter ertragen. Die Casanovas der Meere hätten auch hier möglicherweise noch Parallelen bestätigen können. Sanft schaukelnde Umarmungen richten oftmals auch an Land den ungleich größeren Schaden an.
Die frühen Seeleute, die den Rock ’n’ Roll unwissentlich besangen, hatten damals keine Hand frei für Drumsticks oder E-Gitarren. Und keine Zeit für den narzisstischen Furor und Ennui, der laute Töne gebiert. Wären sie denen begegnet, die viel später die musikalische Horizonterweiterung suchten, hätten sie möglicherweise trotzdem Gemeinsamkeiten gefunden, bei einer Flasche Rum die Tätowierungen verglichen und von ihren Mädels geprahlt. Manche Männer sind so.
Der, der das rocking and rolling der Legende nach aufs Trockene gelegt hat, um eine musikalische Revolution zu benennen, war ein amerikanischer Radio-DJ namens Alan Freed. In seiner Radioshow „Moondog Rock ’n’ Roll House Party“ machte er die weiße Mittelstandsjugend mit schwarzem Rhythm ’n’ Blues bekannt. Das hört sich aus heutiger Sicht aufregender an als der ebenfalls weiße, wenig Erotik versprühende Bill Haley, der nichtsdestoweniger einer der Ersten war, der „Rock, rock, rock everybody, roll, roll, roll everybody“ sang. Die Jugend, von betulichen Nachkriegsklängen in Musik und Gesellschaft gelangweilt bis genervt, folgte ihm euphorisch und wackelte mit den Hüften dazu.
Man könnte auch sagen, der Rock ’n’ Roll war von einer Seebärenfantasie in gut hundert Jahren zur ziemlich deutlichen Körperbewegung geworden, natürlich von niemandem so perfekt wie publikumswirksam ausgeführt wie von dem, den sie „The King“ nannten. Kein Kommandoempfänger mehr, sondern einer, der am Ende das Opfer der eigenen Ansage wurde. Es gab keine Seefahrer unter den Rock ’n’ Rollern; der Rhythmus war zu schnell, zu fordernd, um auf guten Wind zu warten. Der Untergang der Größen, der gleichzeitig das Ende der Jugendbewegung einleitete, erfolgte konsequenterweise in Verkehrsmitteln, mit denen man glaubte, die Zeit überholen zu können. Sie stürzten in Flugzeugen ab wie Buddy Holly oder Ritchie Valens oder fuhren mit Autos in Gräben wie Eddie Cochran oder Gene Vincent. Meist eher unabsichtlich gingen einige Kapitäne viel zu früh von Bord.
Hartnäckig über Wasser gehalten hat sich das Wort sowie die Musik, die es bezeichnet. Verkrampfte Bezüge zu Wind, Wogen und Meer späterer Interpreten wie die schlimmste Seglerballade aller Zeiten, „I am Sailing“, sollten lieber totgeschwiegen werden. Nur wer lange genug dasselbe Gitarrenriff in der größten Rock-’n’-Roll-Band der Welt spielt, wie ein gewisser Keith Richards, wird unsterblich und deswegen als Pirat der Karibik geehrt.
mare-Kulturredakteurin Martina Wimmer, Jahrgang 1965, wurde schon als Kleinkind aufs bayerische Meer mitgenommen und befuhr es später mit dem berüchtigten Partydampfer „Libella“, auf dem ihre bevorzugte Punkdisco die touristische Voralpenidylle zerstörte.
| Vita | mare-Kulturredakteurin Martina Wimmer, Jahrgang 1965, wurde schon als Kleinkind aufs bayerische Meer mitgenommen und befuhr es später mit dem berüchtigten Partydampfer „Libella“, auf dem ihre bevorzugte Punkdisco die touristische Voralpenidylle zerstörte. |
|---|---|
| Person | Von Martina Wimmer |
| Vita | mare-Kulturredakteurin Martina Wimmer, Jahrgang 1965, wurde schon als Kleinkind aufs bayerische Meer mitgenommen und befuhr es später mit dem berüchtigten Partydampfer „Libella“, auf dem ihre bevorzugte Punkdisco die touristische Voralpenidylle zerstörte. |
| Person | Von Martina Wimmer |