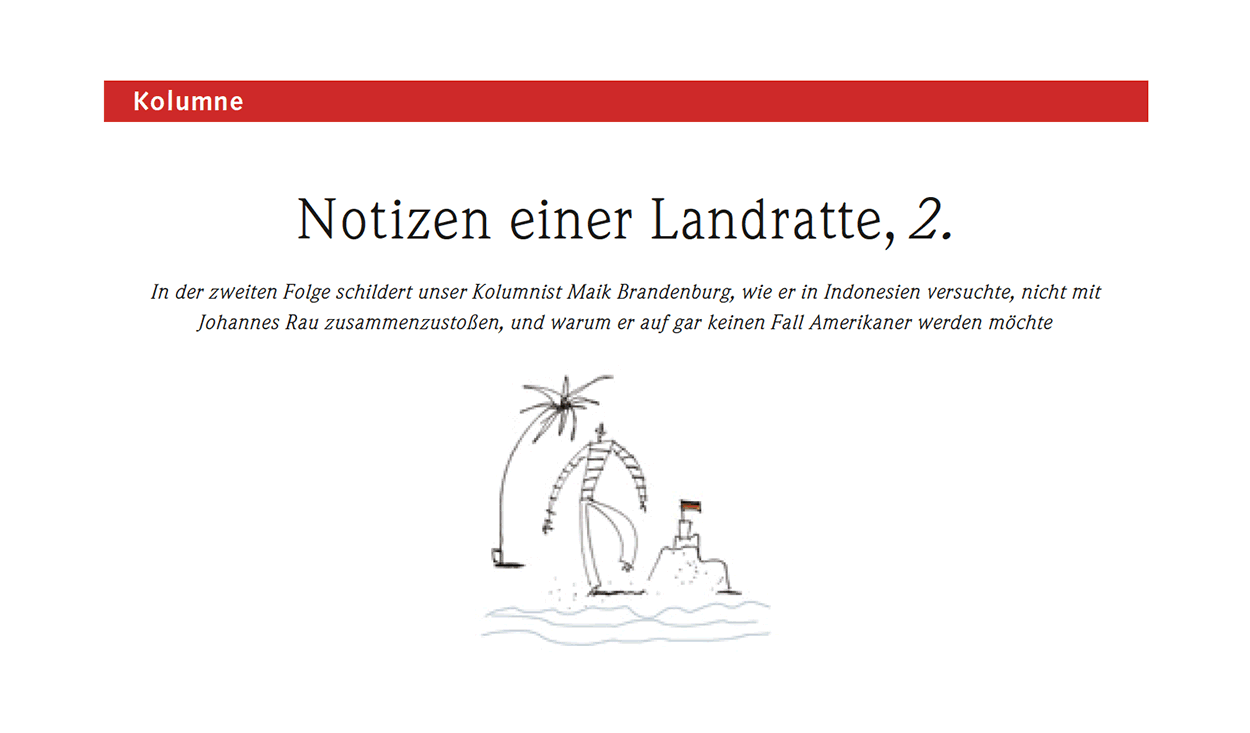Notizen einer Landratte, 2.
Vor ein paar Jahren flog ich nach Sumatra. Weiter war ich noch nie gekommen. Ich ließ mir Spritzen geben. Ich kaufte eine englischsprachige Safarihose („Explorer“). In der Sauna trainierte ich das Überleben bei Tropenhitze. Außerdem überlegte ich mir einen großartigen Satz, den ich nach der Landung an die Welt richten wollte.
Das Erste, was ich auf dem Flughafen sah, war ein Bild von Johannes Rau. Er war mir vorausgereist, auf Staatsbesuch. Natürlich war ich enttäuscht. Das war, als hätte man sich in einem sehr teuren Restaurant ein sehr exotisches Gericht bestellt, Fugu an Tiefseegewürm etwa, und unter der Dekorationskoralle liegt eine Bockwurst. Ich lief durch Indonesiens Straßen und hoffte, nicht mit Johannes Rau zusammenzustoßen.
In meinem Hotel veranstalteten sie eine Deutsche Woche, es gab Bockwurst. In der Lobby tanzten seidene Tausendschönchen in Holzpantoffeln, ein Schild begrüßte die Freunde von „Dutchland“. Das war lustig und wirklich exotisch, aber so richtig weg von zu Hause fühlte ich mich damit auch nicht. Auch Dengo, mein Dolmetscher, half da nicht weiter.
Dengo war ein winziges Wesen, das noch kleiner wirkte, weil es ständig zu Boden blickte. Im Restaurant bestellte ich nur für mich, denn Dengo wollte nichts. Als mein Essen kam, entsicherte er sofort sein Besteck und begann wortlos in meinem Teller zu wühlen. Ich bot ihm wieder ein eigenes Essen an, er aber schlug das Angebot aus. „Meine deutsche Mutter sagte immer“, sagte Dengo, „man soll sparen.“ Deutsche Mutter? Dengo war Indonesier, anderthalb Jahrzehnte aber hatte er in Baden-Württemberg verbracht, bei einem pensionierten Buchhalterpaar. Bald schob er einen zerknitterten Zettel herüber, angeblich ein Dokument. Ich sollte nach meiner Rückkehr wegen seines Bausparvertrags nachfragen. Ich war 20 000 Lichtjahre weg von daheim, ich war auf Sumatra, wo Tiger in den Kneipen hocken. Und wen treffe ich? Einen Schwaben im Sarong, einen indonesischen Häuslebauer, der sich die Raten von seinen Nelkenzigaretten abspart. Ich war satt (der sparsame Dengo dagegen bestellte noch zweimal nach).
Es ist also so eine Sache mit dem Exotischen. Auf den Marshallinseln, einst deutsche Kolonie, begegneten mir eingeborene Müllers und Meiers, wobei einer sogar den Vornamen Kaiser trug. Wie schnell ist da die mühsam erflogene Ferne dahin. Am Strand von Guam glaubte ich an eine Halluzination, nein, eine Hallozination: „Hallo, wie geht’s?“, rief da jemand in perfektem Sächsisch. Es war ein Wissenschaftler aus Dresden, der an der Uni von Guam forschte. Sonne, Sand und Sächsisch – das riss mich vom Strand des Stillen Ozeans an die Ostsee, zurück in meine Kindheit: Die Strände meiner Heimatinsel wurden jeden Sommer von Urlaubern aus dem Süden der DDR besetzt. Reflexartig hielt ich nach einer Sandburg Ausschau. Doch ich sah nur Krebse und Surfer. Ich atmete tief durch.
Die Ferne ist in weite Ferne gerückt. Und ich rede nur von wirklich weit weggen Ländern (um mal meinen Sohn zu Wort kommen zu lassen). Die neuen Kolonien, also Mallorca und befreundete Strände, die Hoheitsgebiete von TUItschland, die lasse ich schon beiseite. „Sonne, Mond und Sterne / das ist noch echte Ferne.“
Dabei geht es uns Deutschen ja noch gut. Wie erst müssen sich Engländer fühlen? Und Amerikaner? Sie können nie einen Fuß vor ihre Haustür setzen, ohne auf Altvertrautes zu stoßen. Ihr Land mäandert um den Globus: Die halbe Welt versteht ihre Sprache. Die halbe Welt trägt ihre Klamotten. Die ganze Welt geht in ihren Imbissbuden essen und trinkt ihre Brause. Ein Ami bucht eine Reise in die Südsee, kaum ist er da, reibt er sich die Augen: Hi, sagt sein Land, ick bün allhier. Amerikaner müssen so etwas wie das Gegenteil von Heimatlosigkeit empfinden. Kein Wunder, dass sie bis zum Mond flogen – ihnen war die Bude auf den Kopf gefallen.
Dies ist nicht der schlimmste Satz, den man in der Fremde hören kann: „Hands up!“ Auch nicht: „Scheiße, das Gegengift wirkt nicht!“ Der schlimmste Satz, der lautet: „Fühlen Sie sich doch wie zu Hause.“
Maik Brandenburg, Jahrgang 1962, studierte Journalistik und arbeitet als freier Autor, u.a. für mare, Geo, Merian. Leidenschaftlicher Vater und Reportage-Fan. Er lebt mit seiner Familie auf der Insel Rügen.
| Vita | Maik Brandenburg, Jahrgang 1962, studierte Journalistik und arbeitet als freier Autor, u.a. für mare, Geo, Merian. Leidenschaftlicher Vater und Reportage-Fan. Er lebt mit seiner Familie auf der Insel Rügen. |
|---|---|
| Person | Von Maik Brandenburg |
| Vita | Maik Brandenburg, Jahrgang 1962, studierte Journalistik und arbeitet als freier Autor, u.a. für mare, Geo, Merian. Leidenschaftlicher Vater und Reportage-Fan. Er lebt mit seiner Familie auf der Insel Rügen. |
| Person | Von Maik Brandenburg |