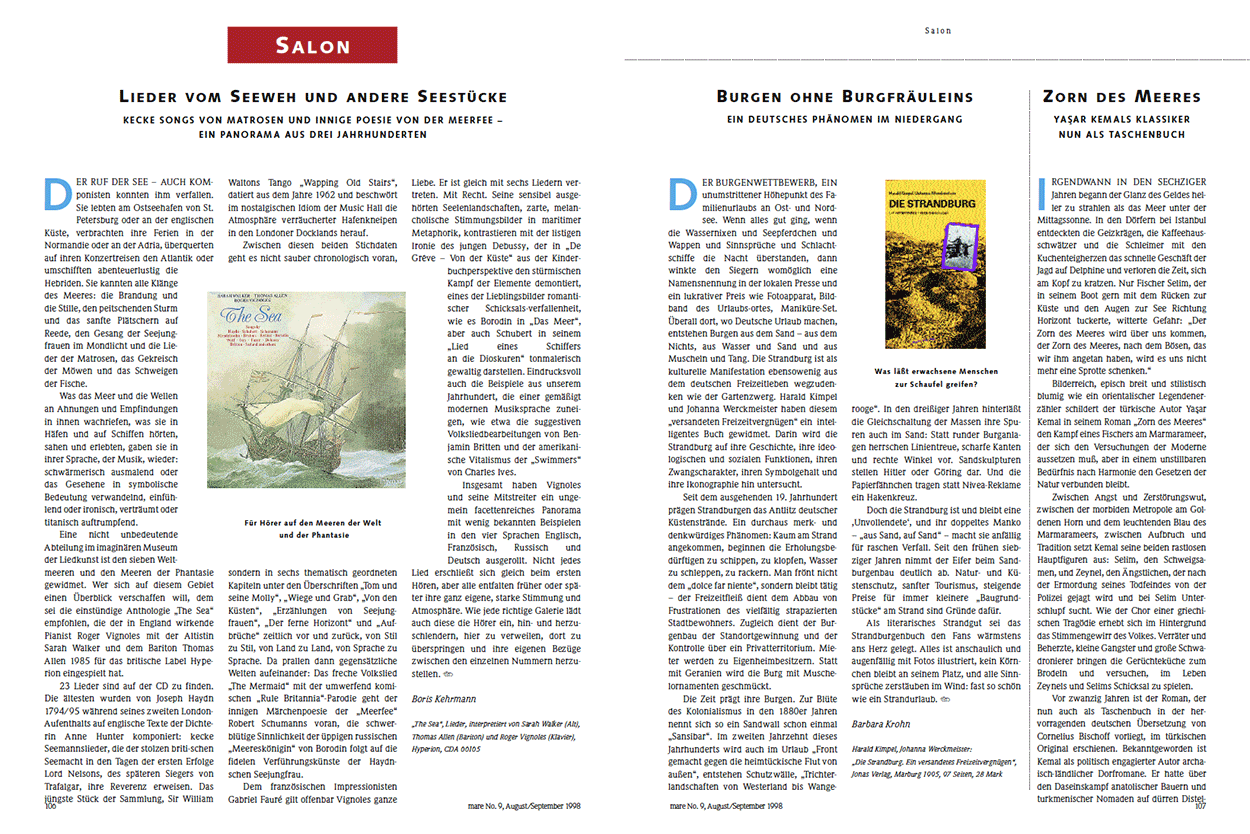mare-Salon
Lieder vom Seeweh und andere Seestücke
Kecke Songs von Matrosen und innige Poesie Von der Meerfee – Ein Panorama aus drei jahrhunderten
Der Ruf der See – auch Komponisten konnten ihm verfallen. Sie lebten am Ostseehafen von St.Petersburg oder an der englischen Küste, verbrachten ihre Ferien in der Normandie oder an der Adria, überquerten auf ihren Konzertreisen den Atlantik oder umschifften abenteuerlustig die Hebriden. Sie kannten alle Klänge des Meeres: die Brandung und die Stille, den peitschenden Sturm und das sanfte Plätschern auf Reede, den Gesang der Seejungfrauen im Mondlicht und die Lieder der Matrosen, das Gekreisch der Möwen und das Schweigen der Fische.
Was das Meer und die Wellen an Ahnungen und Empfindungen in ihnen wachriefen, was sie in Häfen und auf Schiffen hörten, sahen und erlebten, gaben sie in ihrer Sprache, der Musik, wieder: schwärmerisch ausmalend oder das Gesehene in symbolische Bedeutung verwandelnd, einfühlend oder ironisch, verträumt oder titanisch auftrumpfend.
Eine nicht unbedeutende Abteilung im imaginären Museum der Liedkunst ist den sieben Weltmeeren und den Meeren der Phantasie gewidmet. Wer sich auf diesem Gebiet einen Überblick verschaffen will, dem sei die einstündige Anthologie „The Sea“ empfohlen, die der in England wirkende Pianist Roger Vignoles mit der Altistin Sarah Walker und dem Bariton Thomas Allen 1985 für das britische Label Hyperion eingespielt hat.
23 Lieder sind auf der CD zu finden. Die ältesten wurden von Joseph Haydn 1794/95 während seines zweiten London-Aufenthalts auf englische Texte der Dichterin Anne Hunter komponiert: kecke
Seemannslieder, die der stolzen britischen Seemacht in den Tagen der ersten Erfolge Lord Nelsons, des späteren Siegers von Trafalgar, ihre Reverenz erweisen. Das jüngste Stück der Sammlung, Sir William Waltons Tango „Wapping Old Stairs“, datiert aus dem Jahre 1962 und beschwört im nostalgischen Idiom der Music Hall die Atmosphäre verräucherter Hafenkneipen in den Londoner Docklands herauf.
Zwischen diesen beiden Stichdaten geht es nicht sauber chronologisch voran, sondern in sechs thematisch geordneten Kapiteln unter den Überschriften „Tom und seine Molly“, „Wiege und Grab“, „Von den Küsten“, „Erzählungen von Seejungfrauen“, „Der ferne Horizont“ und „Aufbrüche“ zeitlich vor und zurück, von Stil zu Stil, von Land zu Land, von Sprache zu Sprache. Da prallen dann gegensätzliche Welten aufeinander: Das freche Volkslied „The Mermaid“ mit der umwerfend komischen „Rule Britannia“-Parodie geht der innigen Märchenpoesie der „Meerfee“ Robert Schumanns voran, die schwerblütige Sinnlichkeit der üppigen russischen „Meereskönigin“ von Borodin folgt auf die fidelen Verführungskünste der Haydnschen Seejungfrau.
Dem französischen Impressionisten Gabriel Fauré gilt offenbar Vignoles ganze Liebe. Er ist gleich mit sechs Liedern vertreten. Mit Recht. Seine sensibel ausgehörten Seelenlandschaften, zarte, melancholische Stimmungsbilder in maritimer Metaphorik, kontrastieren mit der listigen Ironie des jungen Debussy, der in „De Grêve – Von der Küste“ aus der Kinderbuchperspektive den stürmischen Kampf der Elemente demontiert, eines der Lieblingsbilder romantischer Schicksalsverfallenheit, wie es Borodin in „Das Meer“, aber auch Schubert in seinem „Lied eines Schiffers an die Dioskuren“ tonmalerisch gewaltig darstellen. Eindrucksvoll auch die Beispiele aus unserem Jahrhundert, die einer gemäßigt modernen Musiksprache zuneigen, wie etwa die suggestiven Volksliedbearbeitungen von Benjamin Britten und der amerikanische Vitalismus der „Swimmers“ von Charles Ives.
Insgesamt haben Vignoles und seine Mitstreiter ein ungemein facettenreiches Panorama mit wenig bekannten Beispielen in den vier Sprachen Englisch, Französisch, Russisch und Deutsch ausgerollt. Nicht jedes Lied erschließt sich gleich beim ersten Hören, aber alle entfalten früher oder später ihre ganz eigene, starke Stimmung und Atmosphäre. Wie jede richtige Galerie lädt auch diese die Hörer ein, hin- und herzuschlendern, hier zu verweilen, dort zu überspringen und ihre eigenen Bezüge zwischen den einzelnen Nummern herzustellen. Boris Kehrmann
„The Sea“, Lieder, interpretiert von Sarah Walker (Alt), Thomas Allen (Bariton) und Roger Vignoles (Klavier), Hyperion, CDA 66165
Burgen ohne Burgfräuleins
Ein deutsches Phänomen im Niedergang
Der Burgenwettbewerb, ein unumstrittener Höhepunkt des Familienurlaubs an Ost- und Nordsee. Wenn alles gut ging, wenn die Wassernixen und Seepferdchen und Wappen und Sinnsprüche und Schlachtschiffe die Nacht überstanden, dann winkte den Siegern womöglich eine Namensnennung in der lokalen Presse und ein lukrativer Preis wie Fotoapparat, Bildband des Urlaubsortes, Maniküre-Set. Überall dort, wo Deutsche Urlaub machen, entstehen Burgen aus dem Sand – aus dem Nichts, aus Wasser und Sand und aus Muscheln und Tang. Die Strandburg ist als kulturelle Manifestation ebensowenig aus dem deutschen Freizeitleben wegzudenken wie der Gartenzwerg. Harald Kimpel und Johanna Werckmeister haben diesem „versandeten Freizeitvergnügen“ ein intelligentes Buch gewidmet. Darin wird die Strandburg auf ihre Geschichte, ihre ideologischen und sozialen Funktionen, ihren Zwangscharakter, ihren Symbolgehalt und ihre Ikonographie hin untersucht.
Seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert prägen Strandburgen das Antlitz deutscher Küstenstrände. Ein durchaus merk- und denkwürdiges Phänomen: Kaum am Strand angekommen, beginnen die Erholungsbedürftigen zu schippen, zu klopfen, Wasser zu schleppen, zu rackern. Man frönt nicht dem „dolce far niente“, sondern bleibt tätig – der Freizeitfleiß dient dem Abbau von Frustrationen des vielfältig strapazierten Stadtbewohners. Zugleich dient der Burgenbau der Standortgewinnung und der Kontrolle über ein Privatterritorium. Mieter werden zu Eigenheimbesitzern. Statt mit Geranien wird die Burg mit Muschelornamenten geschmückt.
Die Zeit prägt ihre Burgen. Zur Blüte des Kolonialismus in den 1880er Jahren nennt sich so ein Sandwall schon einmal „Sansibar“. Im zweiten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts wird auch im Urlaub „Front gemacht gegen die heimtückische Flut von außen“, entstehen Schutzwälle, „Trichterlandschaften von Westerland bis Wangerooge“. In den dreißiger Jahren hinterläßt die Gleichschaltung der Massen ihre Spuren auch im Sand: Statt runder Burganlagen herrschen Linientreue, scharfe Kanten und rechte Winkel vor. Sandskulpturen stellen Hitler oder Göring dar. Und die Papierfähnchen tragen statt Nivea-Reklame ein Hakenkreuz.
Doch die Strandburg ist und bleibt eine ,Unvollendete‘, und ihr doppeltes Manko – „aus Sand, auf Sand“ – macht sie anfällig für raschen Verfall. Seit den frühen siebziger Jahren nimmt der Eifer beim Sandburgenbau deutlich ab. Natur- und Küstenschutz, sanfter Tourismus, steigende Preise für immer kleinere „Baugrundstücke“ am Strand sind Gründe dafür.
Als literarisches Strandgut sei das Strandburgenbuch den Fans wärmstens ans Herz gelegt. Alles ist anschaulich und augenfällig mit Fotos illustriert, kein Körnchen bleibt an seinem Platz, und alle Sinnsprüche zerstäuben im Wind: fast so schön wie ein Strandurlaub. Barbara Krohn
Harald Kimpel, Johanna Werckmeister: „Die Strandburg. Ein versandetes Freizeitvergnügen“, Jonas Verlag, Marburg 1995, 97 Seiten, 28 Mark
Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 9. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.
| Vita | mare-Kulturredaktion |
|---|---|
| Person | mare-Kulturredaktion |
| Vita | mare-Kulturredaktion |
| Person | mare-Kulturredaktion |