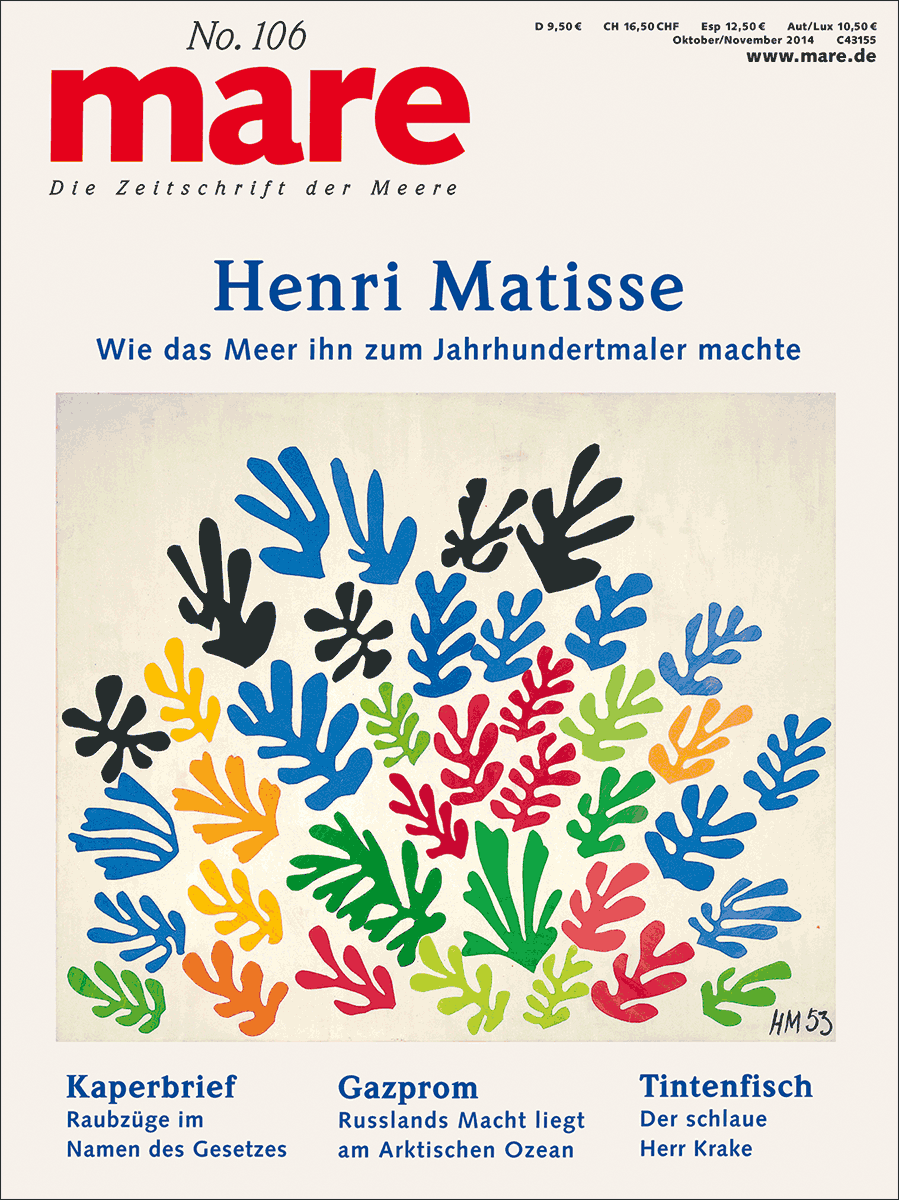Lizenz zum Rauben
William Kidds Leiche hing mehrere Jahre in einem Metallkäfig an einem Galgen. Nach seiner Hinrichtung im Mai 1701 hatten die Henker den Körper geteert, damit er nicht so schnell verweste. Der Leichnam sollte möglichst lange halten und andere abschrecken. Er baumelte am Ufer der Themse im Wind, weit draußen vor London, seewärts, am Tilbury Fort. Krähen pickten an ihm. Der Kot der Möwen verklebte sein Haar. Jeder Seemann, der nach London segelte, sollte die langsam zerfallende Leiche des „hinterhältigsten Piraten aller Zeiten“ sehen.
Dabei war Kidd ein geachteter Reeder und Kapitän gewesen. Der englische König William III. hatte ihn für seine Verdienste sogar ausgezeichnet. In den 1680er-Jahren hatte Kidd die Karibikinsel Nevis, eine englische Kolonie, gegen die Franzosen verteidigt. Kidd hatte französische Schiffe aufgebracht – zum Wohlgefallen des englischen Königs, der gegen Frankreich Krieg führte.
Kidd war ein Kaperfahrer, einer jener Kapitäne, die im Auftrag eines Herrschers Handelsschiffe verfeindeter Staaten überfielen. Zu Kidds Zeiten war die Kaperei längst ein etabliertes Geschäft, eine einträgliche und relativ billige Methode, um den Feind zu schwächen. Statt eine teure Flotte aufzubauen und den Gegner direkt anzugreifen, engagierten Fürsten und Könige freie Kapitäne, die die Handelsschiffe überfielen. Mitunter erbeuteten die Kaperer viel Gold, Silber, Seide oder wertvolle Gewürze.
Diese Kriegstaktik kleiner Nadelstiche war ein lohnendes Geschäft, bei dem adelige Finanziers gerne mitmischten. Sie schossen Geld zu, um Schiffe mit Waffen und Mannschaften auszurüsten. Bei diesen morbiden Risikokapitalgeschäften sicherte der Kapitän ihnen und dem Fürstenhaus per Vertrag einen Anteil an der Beute zu. Dem Kapitän wiederum stellten Fürst oder König eine Lizenz zum Kapern aus: den Kaperbrief.
Die Selbstverständlichkeit, mit der der Adel zur Feindfahrt aufrief, wirkt heute ausgesprochen dreist. In einem „Patent, betreffend die Kaperfahrt für die Herzogthümer Schleswig und Holstein“ des dänischen Königs Frederik von 1813 ist in feinstem Bürokratendeutsch definiert, dass die „Bestimmungen aus den Paragrafen 6, 8, 11 und 34 bei Ansehung großbritannischer Schiffe und Häfen auf alle feindlichen Schiffe und Häfen Anwendung finden sollen“. Kurz: Die Seeleute aus den seinerzeit dänischen Herzogtümern Schleswig und Holstein durften Briten guten Gewissens überfallen.
Ein solcher Kaperbrief nützte dem Kaperer zwar nichts, wenn der Feind ihn erwischte. Vor seinen Landsleuten oder den Behörden in den Kolonien aber konnte er damit nachweisen, dass er im Namen des Herrn auf Raubzug war. Meist bestand der Kaperbrief aus dickem Papier oder starkem, wasserfestem Pergament. Der Herzog oder König unterzeichnete persönlich und heftete in vielen Fällen zusätzlich ein Wachssiegel neben die Signatur. Den Kopf des Briefes zierte das Wappen des Adelshauses. Manchmal verzierten Schreiber den Briefkopf mit feinen Tuschezeichnungen von Löwen, Vögeln oder anderen Wappentieren. Darunter stand verschnörkelt in großen Lettern der Name des Herrschers.
Den Kaperbrief gab es in zweifacher Ausführung – ein Dokument verblieb bei der Admiralität, das zweite erhielt der Kapitän, der es während der Fahrt mit sich führen musste. Für Kaperfahrten heuerte die Admiralität in der Regel erfahrene und erfolgreiche Handelskapitäne an. In manchen Fällen bewarben sich die Kapitäne als Kaperfahrer. Bei Bedarf aber bot die Admiralität erfahrenen Schiffsführern den Kapervertrag direkt an.
So war es auch bei William Kidd, als er im April 1696 zu seiner letzten Fahrt aufbrach. Er sollte Piraten im Indischen Ozean jagen und ausrauben, die immer öfter die englischen Handelsschiffe auf der Route nach Asien überfielen. Die englische Handelsgesellschaft East India Company hatte dem König Druck gemacht, endlich etwas gegen die Piraterie zu unternehmen.
Also engagierte man Kidd, den erfahrenen Kaperfahrer. Die Finanziers versprachen sich fette Gewinne. Das Königshaus sollte gleich doppelt profitieren. Es sollte zehn Prozent des Gewinns erhalten. Nebenbei konnte der König die East India Company besänftigen. Wem die Waren ursprünglich gehört hatten, spielte keine Rolle. Kidd sollte einfach so viel wie möglich erbeuten.
Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 106. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.
Tim Schröder, Jahrgang 1970, Journalist in Oldenburg, staunte, als er erfuhr, dass erst mit der Pariser Seerechtserklärung 1856 die legale Kaperei abgeschafft wurde.
| Vita | Tim Schröder, Jahrgang 1970, Journalist in Oldenburg, staunte, als er erfuhr, dass erst mit der Pariser Seerechtserklärung 1856 die legale Kaperei abgeschafft wurde. |
|---|---|
| Person | Von Tim Schröder |
| Vita | Tim Schröder, Jahrgang 1970, Journalist in Oldenburg, staunte, als er erfuhr, dass erst mit der Pariser Seerechtserklärung 1856 die legale Kaperei abgeschafft wurde. |
| Person | Von Tim Schröder |