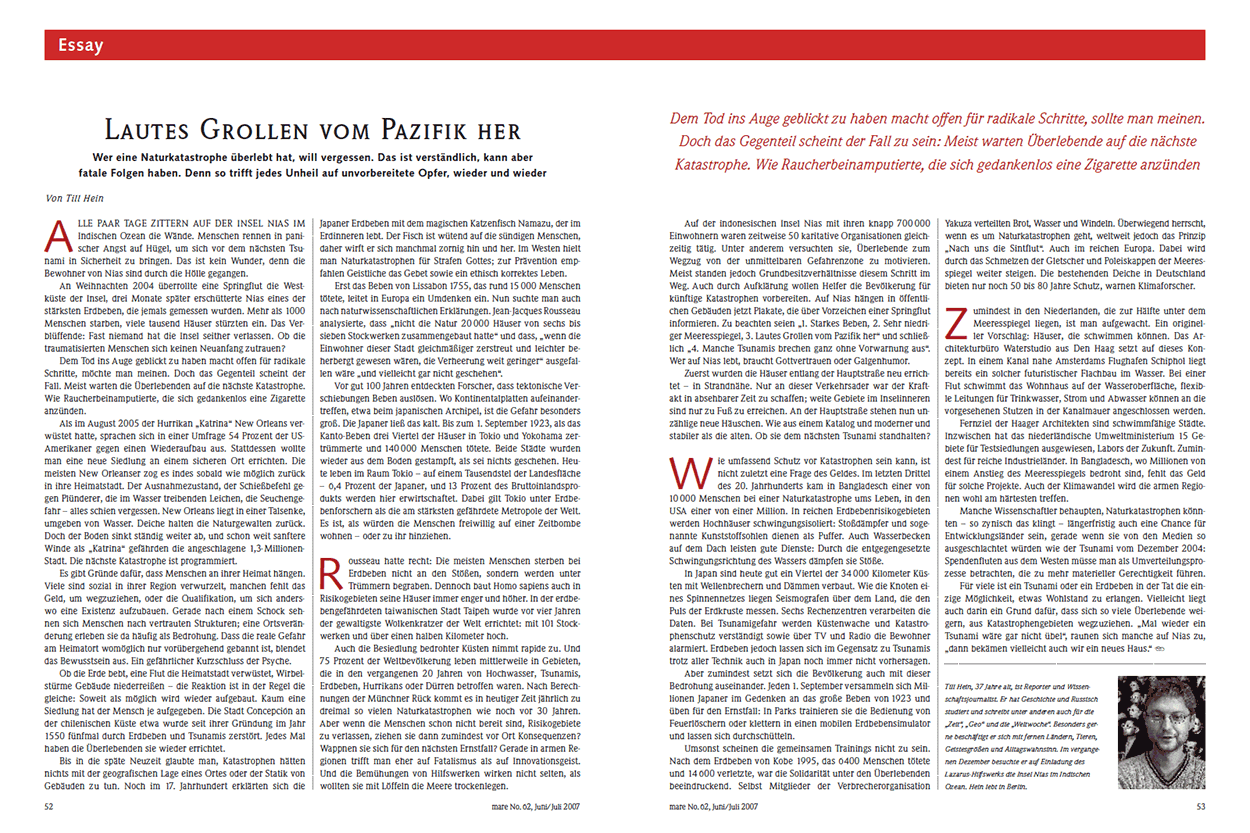Lautes Grollen vom Pazifik her
Alle paar Tage zittern auf der Insel Nias im Indischen Ozean die Wände. Menschen rennen in panischer Angst auf Hügel, um sich vor dem nächsten Tsunami in Sicherheit zu bringen. Das ist kein Wunder, denn die Bewohner von Nias sind durch die Hölle gegangen.
An Weihnachten 2004 überrollte eine Springflut die Westküste der Insel, drei Monate später erschütterte Nias eines der stärksten Erdbeben, die jemals gemessen wurden. Mehr als 1000 Menschen starben, viele tausend Häuser stürzten ein. Das Verblüffende: Fast niemand hat die Insel seither verlassen. Ob die traumatisierten Menschen sich keinen Neuanfang zutrauen?
Dem Tod ins Auge geblickt zu haben macht offen für radikale Schritte, möchte man meinen. Doch das Gegenteil scheint der Fall. Meist warten die Überlebenden auf die nächste Katastrophe. Wie Raucherbeinamputierte, die sich gedankenlos eine Zigarette anzünden.
Als im August 2005 der Hurrikan „Katrina“ New Orleans verwüstet hatte, sprachen sich in einer Umfrage 54 Prozent der US-Amerikaner gegen einen Wiederaufbau aus. Stattdessen wollte man eine neue Siedlung an einem sicheren Ort errichten. Die meisten New Orleanser zog es indes sobald wie möglich zurück in ihre Heimatstadt. Der Ausnahmezustand, der Schießbefehl gegen Plünderer, die im Wasser treibenden Leichen, die Seuchengefahr – alles schien vergessen. New Orleans liegt in einer Talsenke, umgeben von Wasser. Deiche halten die Naturgewalten zurück. Doch der Boden sinkt ständig weiter ab, und schon weit sanftere Winde als „Katrina“ gefährden die angeschlagene 1,3-Millionen-Stadt. Die nächste Katastrophe ist programmiert.
Es gibt Gründe dafür, dass Menschen an ihrer Heimat hängen. Viele sind sozial in ihrer Region verwurzelt, manchen fehlt das Geld, um wegzuziehen, oder die Qualifikation, um sich anderswo eine Existenz aufzubauen. Gerade nach einem Schock sehnen sich Menschen nach vertrauten Strukturen; eine Ortsveränderung erleben sie da häufig als Bedrohung. Dass die reale Gefahr am Heimatort womöglich nur vorübergehend gebannt ist, blendet das Bewusstsein aus. Ein gefährlicher Kurzschluss der Psyche.
Ob die Erde bebt, eine Flut die Heimatstadt verwüstet, Wirbelstürme Gebäude niederreißen – die Reaktion ist in der Regel die gleiche: Soweit als möglich wird wieder aufgebaut. Kaum eine Siedlung hat der Mensch je aufgegeben. Die Stadt Concepción an der chilenischen Küste etwa wurde seit ihrer Gründung im Jahr 1550 fünfmal durch Erdbeben und Tsunamis zerstört. Jedes Mal haben die Überlebenden sie wieder errichtet.
Bis in die späte Neuzeit glaubte man, Katastrophen hätten nichts mit der geografischen Lage eines Ortes oder der Statik von Gebäuden zu tun. Noch im 17. Jahrhundert erklärten sich die Japaner Erdbeben mit dem magischen Katzenfisch Namazu, der im Erd-inneren lebt. Der Fisch ist wütend auf die sündigen Menschen, daher wirft er sich manchmal zornig hin und her. Im Westen hielt man Naturkatastrophen für Strafen Gottes; zur Prävention empfahlen Geistliche das Gebet sowie ein ethisch korrektes Leben.
Erst das Beben von Lissabon 1755, das rund 15000 Menschen tötete, leitet in Europa ein Umdenken ein. Nun suchte man auch nach naturwissenschaftlichen Erklärungen. Jean-Jacques Rousseau analysierte, dass „nicht die Natur 20000 Häuser von sechs bis sieben Stockwerken zusammengebaut hatte“ und dass, „wenn die Einwohner dieser Stadt gleichmäßiger zerstreut und leichter beherbergt gewesen wären, die Verheerung weit geringer“ ausgefallen wäre „und vielleicht gar nicht geschehen“.
Vor gut 100 Jahren entdeckten Forscher, dass tektonische Verschiebungen Beben auslösen. Wo Kontinentalplatten aufeinandertreffen, etwa beim japanischen Archipel, ist die Gefahr besonders groß. Die Japaner ließ das kalt. Bis zum 1. September 1923, als das Kanto-Beben drei Viertel der Häuser in Tokio und Yokohama zertrümmerte und 140.000 Menschen tötete. Beide Städte wurden wieder aus dem Boden gestampft, als sei nichts geschehen. Heute leben im Raum Tokio – auf einem Tausendstel der Landesfläche – 6,4 Prozent der Japaner, und 13 Prozent des Bruttoinlandsprodukts werden hier erwirtschaftet. Dabei gilt Tokio unter Erdbebenforschern als die am stärksten gefährdete Metropole der Welt. Es ist, als würden die Menschen freiwillig auf einer Zeitbombe wohnen – oder zu ihr hinziehen.
Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 62. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.
Till Hein, 1969 in Salzburg geboren, ist Reporter und Wissenschaftsjournalist. Er hat Geschichte und Russisch studiert und schreibt unter anderen auch für die Zeit, Geo und die Weltwoche. Besonders gerne beschäftigt er sich mit fernen Ländern, Tieren, Geistesgrößen und Alltagswahnsinn. Im vergangenen Dezember besuchte er auf Einladung des Lazarus-Hilfswerks die Insel Nias im Indischen Ozean. Hein lebt in Berlin.
| Vita | Till Hein, 1969 in Salzburg geboren, ist Reporter und Wissenschaftsjournalist. Er hat Geschichte und Russisch studiert und schreibt unter anderen auch für die Zeit, Geo und die Weltwoche. Besonders gerne beschäftigt er sich mit fernen Ländern, Tieren, Geistesgrößen und Alltagswahnsinn. Im vergangenen Dezember besuchte er auf Einladung des Lazarus-Hilfswerks die Insel Nias im Indischen Ozean. Hein lebt in Berlin. |
|---|---|
| Person | Von Till Hein |
| Vita | Till Hein, 1969 in Salzburg geboren, ist Reporter und Wissenschaftsjournalist. Er hat Geschichte und Russisch studiert und schreibt unter anderen auch für die Zeit, Geo und die Weltwoche. Besonders gerne beschäftigt er sich mit fernen Ländern, Tieren, Geistesgrößen und Alltagswahnsinn. Im vergangenen Dezember besuchte er auf Einladung des Lazarus-Hilfswerks die Insel Nias im Indischen Ozean. Hein lebt in Berlin. |
| Person | Von Till Hein |