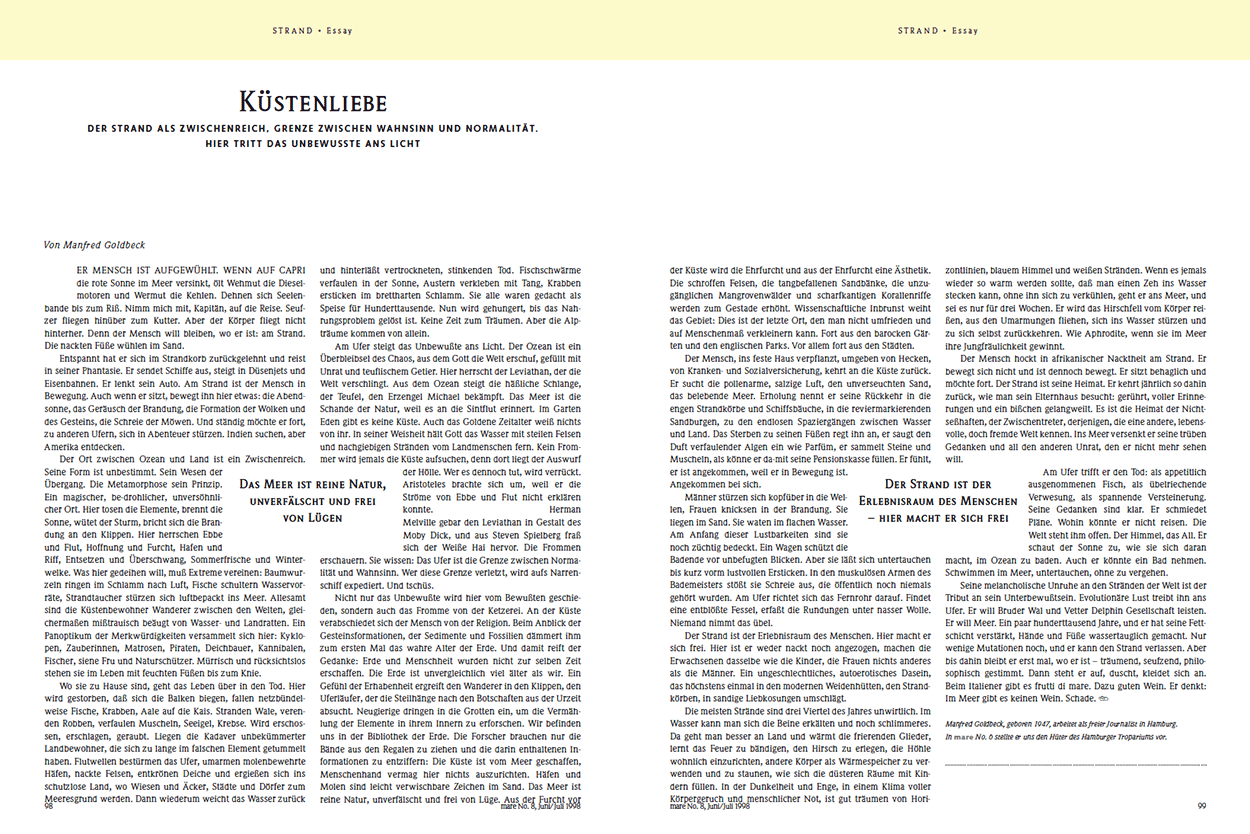Küstenliebe
Der Mensch ist aufgewühlt. Wenn auf Capri die rote Sonne im Meer versinkt, ölt Wehmut die Dieselmotoren und Wermut die Kehlen. Dehnen sich Seelenbande bis zum Riss. Nimm mich mit, Kapitän, auf die Reise. Seufzer fliegen hinüber zum Kutter. Aber der Körper fliegt nicht hinterher. Denn der Mensch will bleiben, wo er ist: am Strand. Die nackten Füße wühlen im Sand.
Entspannt hat er sich im Strandkorb zurückgelehnt und reist in seiner Phantasie. Er sendet Schiffe aus, steigt in Düsenjets und Eisenbahnen. Er lenkt sein Auto. Am Strand ist der Mensch in Bewegung. Auch wenn er sitzt, bewegt ihn hier etwas: die Abendsonne, das Geräusch der Brandung, die Formation der Wolken und des Gesteins, die Schreie der Möwen. Und ständig möchte er fort, zu anderen Ufern, sich in Abenteuer stürzen. Indien suchen, aber Amerika entdecken.
Der Ort zwischen Ozean und Land ist ein Zwischenreich. Seine Form ist unbestimmt. Sein Wesen der Übergang. Die Metamorphose sein Prinzip. Ein magischer, bedrohlicher, unversöhnlicher Ort. Hier tosen die Elemente, brennt die Sonne, wütet der Sturm, bricht sich die Brandung an den Klippen. Hier herrschen Ebbe und Flut, Hoffnung und Furcht, Hafen und Riff, Entsetzen und Überschwang, Sommerfrische und Winterwelke. Was hier gedeihen will, muss Extreme vereinen: Baumwurzeln ringen im Schlamm nach Luft, Fische schultern Wasservorräte, Strandtaucher stürzen sich luftbepackt ins Meer. Allesamt sind die Küstenbewohner Wanderer zwischen den Welten, gleichermaßen misstrauisch beäugt von Wasser- und Landratten. Ein Panoptikum der Merkwürdigkeiten versammelt sich hier: Kyklopen, Zauberinnen, Matrosen, Piraten, Deichbauer, Kannibalen, Fischer, siene Fru und Naturschützer. Mürrisch und rücksichtslos stehen sie im Leben mit feuchten Füßen bis zum Knie.
Wo sie zu Hause sind, geht das Leben über in den Tod. Hier wird gestorben, dass sich die Balken biegen, fallen netzbündelweise Fische, Krabben, Aale auf die Kais. Stranden Wale, verenden Robben, verfaulen Muscheln, Seeigel, Krebse. Wird erschossen, erschlagen, geraubt.
Liegen die Kadaver unbekümmerter Landbewohner, die sich zu lange im falschen Element getummelt haben. Flutwellen bestürmen das Ufer, umarmen molenbewehrte Häfen, nackte Felsen, entkrönen Deiche und ergießen sich ins schutzlose Land, wo Wiesen und Äcker, Städte und Dörfer zum Meeresgrund werden. Dann wiederum weicht das Wasser zurück und hinterlässt vertrockneten, stinkenden Tod. Fischschwärme verfaulen in der Sonne, Austern verkleben mit Tang, Krabben ersticken im brettharten Schlamm. Sie alle waren gedacht als Speise für Hunderttausende. Nun wird gehungert, bis das Nahrungsproblem gelöst ist. Keine Zeit zum Träumen. Aber die Alpträume kommen von allein.
Am Ufer steigt das Unbewusste ans Licht. Der Ozean ist ein Überbleibsel des Chaos, aus dem Gott die Welt erschuf, gefüllt mit Unrat und teuflischem Getier. Hier herrscht der Leviathan, der die Welt verschlingt. Aus dem Ozean steigt die hässliche Schlange, der Teufel, den Erzengel Michael bekämpft. Das Meer ist die Schande der Natur, weil es an die Sintflut erinnert. Im Garten Eden gibt es keine Küste. Auch das Goldene Zeitalter weiß nichts von ihr. In seiner Weisheit hält Gott das Wasser mit steilen Felsen und nachgiebigen Stränden vom Landmenschen fern. Kein Frommer wird jemals die Küste aufsuchen, denn dort liegt der Auswurf der Hölle. Wer es dennoch tut, wird verrückt. Aristoteles brachte sich um, weil er die Ströme von Ebbe und Flut nicht erklären konnte. Herman Melville gebar den Leviathan in Gestalt des Moby Dick, und aus Steven Spielberg fraß sich der Weiße Hai hervor. Die Frommen erschauern. Sie wissen: Das Ufer ist die Grenze zwischen Normalität und Wahnsinn. Wer diese Grenze verletzt, wird aufs Narrenschiff expediert. Und tschüs.
Nicht nur das Unbewusste wird hier vom Bewussten geschieden, sondern auch das Fromme von der Ketzerei. An der Küste verabschiedet sich der Mensch von der Religion. Beim Anblick der Gesteinsformationen, der Sedimente und Fossilien dämmert ihm zum ersten Mal das wahre Alter der Erde. Und damit reift der Gedanke: Erde und Menschheit wurden nicht zur selben Zeit erschaffen. Die Erde ist unvergleichlich viel älter als wir. Ein Gefühl der Erhabenheit ergreift den Wanderer in den Klippen, den Uferläufer, der die Steilhänge nach den Botschaften aus der Urzeit absucht. Neugierige dringen in die Grotten ein, um die Vermählung der Elemente in ihrem Innern zu erforschen. Wir befinden uns in der Bibliothek der Erde. Die Forscher brauchen nur die Bände aus den Regalen zu ziehen und die darin enthaltenen Informationen zu entziffern: Die Küste ist vom Meer geschaffen, Menschenhand vermag hier nichts auszurichten.
Häfen und Molen sind leicht verwischbare Zeichen im Sand. Das Meer ist reine Natur, unverfälscht und frei von Lüge. Aus der Furcht vor der Küste wird die Ehrfurcht und aus der Ehrfurcht eine Ästhetik. Die schroffen Felsen, die tangbefallenen Sandbänke, die unzugänglichen Mangrovenwälder und scharfkantigen Korallenriffe werden zum Gestade erhöht. Wissenschaftliche Inbrunst weiht das Gebiet: Dies ist der letzte Ort, den man nicht umfrieden und auf Menschenmaß verkleinern kann. Fort aus den barocken Gärten und den englischen Parks. Vor allem fort aus den Städten.
Der Mensch, ins feste Haus verpflanzt, umgeben von Hecken, von Kranken- und Sozialversicherung, kehrt an die Küste zurück. Er sucht die pollenarme, salzige Luft, den unverseuchten Sand, das belebende Meer. Erholung nennt er seine Rückkehr in die engen Strandkörbe und Schiffsbäuche, in die reviermarkierenden Sandburgen, zu den endlosen Spaziergängen zwischen Wasser und Land. Das Sterben zu seinen Füßen regt ihn an, er saugt den Duft verfaulender Algen ein wie Parfüm, er sammelt Steine und Muscheln, als könne er damit seine Pensionskasse füllen. Er fühlt, er ist angekommen, weil er in Bewegung ist. Angekommen bei sich.
Männer stürzen sich kopfüber in die Wellen, Frauen knicksen in der Brandung. Sie liegen im Sand. Sie waten im flachen Wasser. Am Anfang dieser Lustbarkeiten sind sie noch züchtig bedeckt. Ein Wagen schützt die Badende vor unbefugten Blicken. Aber sie lässt sich untertauchen bis kurz vorm lustvollen Ersticken. In den muskulösen Armen des Bademeisters stößt sie Schreie aus, die öffentlich noch niemals gehört wurden. Am Ufer richtet sich das Fernrohr darauf. Findet eine entblößte Fessel, erfasst die Rundungen unter nasser Wolle. Niemand nimmt das übel.
Der Strand ist der Erlebnisraum des Menschen. Hier macht er sich frei. Hier ist er weder nackt noch angezogen, machen die Erwachsenen dasselbe wie die Kinder, die Frauen nichts anderes als die Männer. Ein ungeschlechtliches, autoerotisches Dasein, das höchstens einmal in den modernen Weidenhütten, den Strandkörben, in sandige Liebkosungen umschlägt.
Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 8. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.
Manfred Goldbeck, geboren 1947, arbeitet als freier Journalist in Hamburg. In mare No. 6 stellte er uns den Hüter des Hamburger Tropariums vor.
| Vita | Manfred Goldbeck, geboren 1947, arbeitet als freier Journalist in Hamburg. In mare No. 6 stellte er uns den Hüter des Hamburger Tropariums vor. |
|---|---|
| Person | Ein Essay von Manfred Goldbeck |
| Vita | Manfred Goldbeck, geboren 1947, arbeitet als freier Journalist in Hamburg. In mare No. 6 stellte er uns den Hüter des Hamburger Tropariums vor. |
| Person | Ein Essay von Manfred Goldbeck |