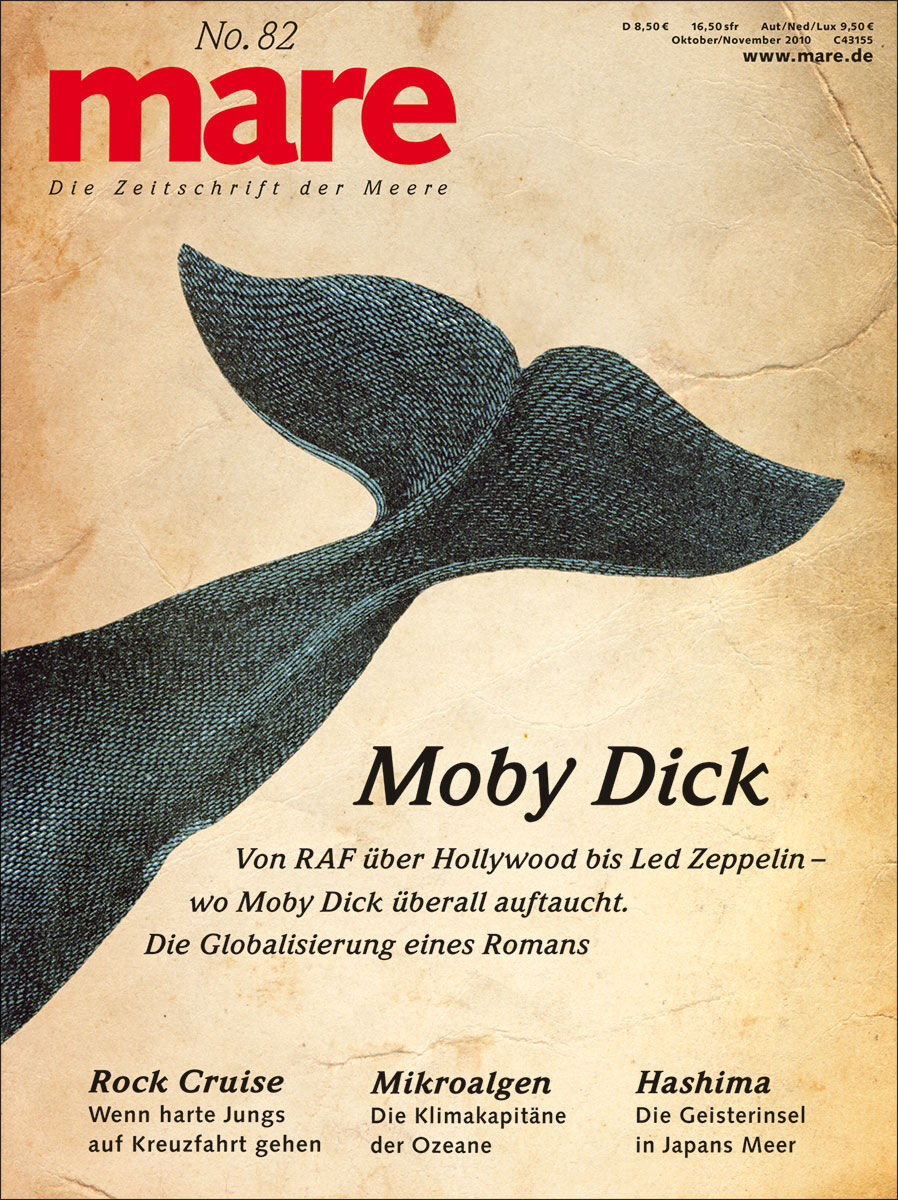Die Geisterinsel
Im Südwesten von Japan, dort, wo das Land am schönsten ist und grün behaarte Vulkane in den Himmel ragen, gibt es eine Insel, die hässlich ist. Die Menschen nennen sie Gunkanjima, „Kriegsschiffinsel“, weil ihre Form an einen Zerstörer erinnert.
Und die Insel ist nicht nur unansehnlich, sie ist ausgesprochen ungastlich, sie verschanzt sich hinter einer riesigen Mauer, die sie vor dem Meer und vor Eindringlingen schützt. Wer sie trotzdem betritt, sieht Beton, nichts als Beton. Verlassene Wohnhäuser dicht an dicht, sieben-, acht-, neunstöckig, eine zerstörte Schule, ein verwahrlostes Krankenhaus, eine tote, entseelte Stadt. Lebendig ist nur das Moos an den kaputten Fassaden. Wo selbst das Moos nicht wohnen mag, hat sich Schimmel breitgemacht. Wenn es die Hölle wirklich gibt, dann sieht sie womöglich aus wie dieses Eiland. Es ist der Lieblingsort von Doutoko Sakamoto.
„Die Insel ist ein Teil von mir“, sagt Doutoku Sakamoto. Jedes Mal, wenn er sie besucht, hält er für ein paar Minuten inne, schaut auf die Ruinen, und auf einmal ist alles wieder da: der Lärm der Förderbänder, der feine Kohlestaub in der Luft, der Vater, der nach der Schicht heimkommt und Sake trinkt, die Mutter, wie sie mit einem Korb unterm Arm zum inseleigenen Markt aufbricht, und er selbst, wie er jede Gelegenheit nutzt, um auf dem Dach eines der Hochhäuser Gedichte zu schreiben. „Ich habe es geliebt zu schreiben, und ich habe es geliebt zu lesen, zum Beispiel Goethe.“ Er sagt es, und für einen Moment ist er wieder der zwölfjährige, wissenshungrige Junge eines Kohlearbeiters, der er damals war. „Es war ein gutes Leben auf der Insel.“
Jetzt, Jahrzehnte später, steht er wieder da, auf dem ehemaligen Sportplatz, doch das Leben, von dem er spricht, gibt es nicht mehr. Vor ihm liegt seine Kindheit, zerfressen von der Natur, begraben unter Beton und Unkraut. Still ist es geworden auf Gunkanjima. 1974 haben die letzten Menschen die Insel verlassen. Seitdem ist sie unbewohnt. Eine Geisterinsel.
Was waren das für verrückte Jahre, damals, als kleiner Bursche an diesem irren Ort. So viele Maschinen, so viele behelmte Männer in Uniformen. Bewundert hat er sie, ihren Mut, ihre Kraft. Es waren Tausende Kohlearbeiter, die hier einst in den Minen unter dem Meer schufteten, ein gefährlicher Job, bei dem nicht wenige ihr Leben verloren. Sie kamen aus ganz Japan, angelockt von der Aussicht auf gut bezahlte Arbeit. Sie zogen in die gigantischen Wohnanlagen, die damals als Zukunftsarchitektur galten, und machten Gunkanjima zu dem Ort mit der höchsten Bevölkerungsdichte der Welt. 5267 Menschen lebten zu Hochzeiten auf der Insel, die nur 480 mal 160 Meter misst. Das sind 836 Menschen je Hektar, rund sechsmal mehr als im heutigen Tokio.
Schon 1869 hatte man die erste Mine in Japan gebaut, drüben auf der größeren Nachbarinsel Takashima, mithilfe schottischer Ingenieure. Kohle war damals ein wichtiger Brennstoff für die Salzgewinnung. Der Erfolg der Mine war beachtlich, und so dauerte es nicht lange, bis auch die Firma Mitsubishi ins Kohlegeschäft einstieg. 1890 kaufte sie für einen Spottpreis die Insel Gunkanjima, die eigentlich den Namen Hashima („Grenzinsel“) trägt, und baute einen fast 200 Meter langen Förderschacht. Für ihre Arbeiter errichtete sie eine monströse Plattenbausiedlung aus Beton, eine groteske Musterstadt mitten im Meer, in der die Arbeiter in winzigen Wohnzellen hausten. Nur der Manager residierte im einzigen Einfamilienhaus auf dem höchsten Punkt der Insel, rund 40 Meter über dem Meer.
Der Kohlebedarf schnellte in die Höhe, die Insel boomte, es waren die 1920er, 30er, 40er Jahre, bis zu 400 000 Tonnen Kohle im Jahr hackten und schaufelten die Kumpel aus der Tiefe, dann kamen die 1950er und 1960er Jahre, die Blütezeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Nirgendwo sonst ließ sich Japans Aufstieg zur Industrienation besser beobachten als hier. Doch was war das für ein Leben? So beengt, so abgeschnitten vom Rest der Welt? Eingesperrt auf einem Eiland 15 Kilometer vor Nagasaki, von dem Spötter sagen, man könne es binnen einer Zigarettenlänge durchqueren?
Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 82. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.
Jan Keith, Jahrgang 1971, mare-Redakteur und Halbjapaner, wäre beinahe nicht auf die Insel gekommen. Erst spielte das Wetter verrückt, dann die Behörden.
Guillaume Herbaut, geboren 1970, Fotograf bei der Agentur Institute, kennt sich aus mit verlassenen Orten. Mehrere Mal reiste er für ein Projekt nach Tschernobyl.
| Vita | Jan Keith, Jahrgang 1971, mare-Redakteur und Halbjapaner, wäre beinahe nicht auf die Insel gekommen. Erst spielte das Wetter verrückt, dann die Behörden.
Guillaume Herbaut, geboren 1970, Fotograf bei der Agentur Institute, kennt sich aus mit verlassenen Orten. Mehrere Mal reiste er für ein Projekt nach Tschernobyl. |
|---|---|
| Person | Von Jan Keith und Guillaume Herbaut |
| Vita | Jan Keith, Jahrgang 1971, mare-Redakteur und Halbjapaner, wäre beinahe nicht auf die Insel gekommen. Erst spielte das Wetter verrückt, dann die Behörden.
Guillaume Herbaut, geboren 1970, Fotograf bei der Agentur Institute, kennt sich aus mit verlassenen Orten. Mehrere Mal reiste er für ein Projekt nach Tschernobyl. |
| Person | Von Jan Keith und Guillaume Herbaut |