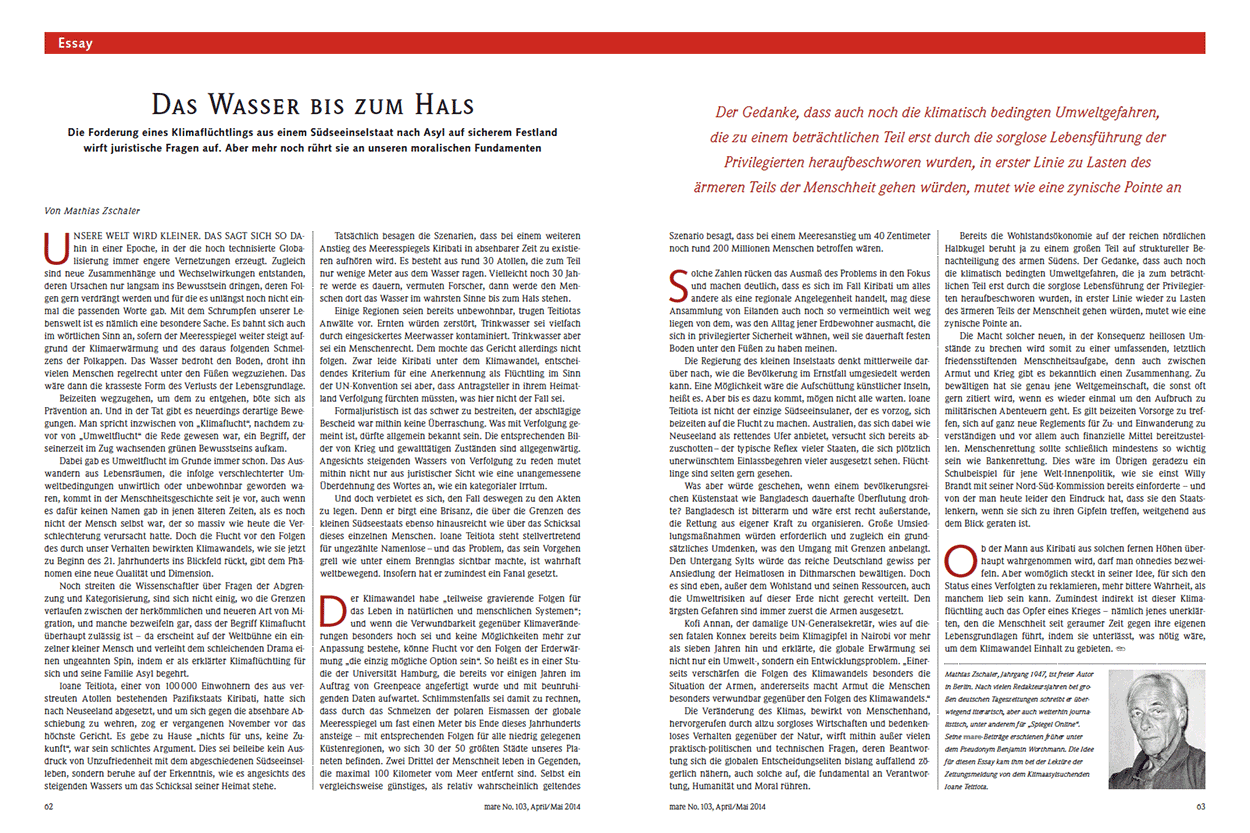Das Wasser bis zum Hals
Unsere Welt wird kleiner. Das sagt sich so dahin in einer Epoche, in der die hoch technisierte Globalisierung immer engere Vernetzungen erzeugt. Zugleich sind neue Zusammenhänge und Wechselwirkungen entstanden, deren Ursachen nur langsam ins Bewusstsein dringen, deren Folgen gern verdrängt werden und für die es unlängst noch nicht einmal die passenden Worte gab. Mit dem Schrumpfen unserer Lebenswelt ist es nämlich eine besondere Sache. Es bahnt sich auch im wörtlichen Sinn an, sofern der Meeresspiegel weiter steigt aufgrund der Klimaerwärmung und des daraus folgenden Schmelzens der Polkappen. Das Wasser bedroht den Boden, droht ihn vielen Menschen regelrecht unter den Füßen wegzuziehen. Das wäre dann die krasseste Form des Verlusts der Lebensgrundlage.
Beizeiten wegzugehen, um dem zu entgehen, böte sich als Prävention an. Und in der Tat gibt es neuerdings derartige Bewegungen. Man spricht inzwischen von „Klimaflucht“, nachdem zuvor von „Umweltflucht“ die Rede gewesen war, ein Begriff, der seinerzeit im Zug wachsenden grünen Bewusstseins aufkam.
Dabei gab es Umweltflucht im Grunde immer schon. Das Auswandern aus Lebensräumen, die infolge verschlechterter Umweltbedingungen unwirtlich oder unbewohnbar geworden waren, kommt in der Menschheitsgeschichte seit je vor, auch wenn es dafür keinen Namen gab in jenen älteren Zeiten, als es noch nicht der Mensch selbst war, der so massiv wie heute die Verschlechterung verursacht hatte. Doch die Flucht vor den Folgen des durch unser Verhalten bewirkten Klimawandels, wie sie jetzt zu Beginn des 21. Jahrhunderts ins Blickfeld rückt, gibt dem Phänomen eine neue Qualität und Dimension.
Noch streiten die Wissenschaftler über Fragen der Abgrenzung und Kategorisierung, sind sich nicht einig, wo die Grenzen verlaufen zwischen der herkömmlichen und neueren Art von Migration, und manche bezweifeln gar, dass der Begriff Klimaflucht überhaupt zulässig ist – da erscheint auf der Weltbühne ein einzelner kleiner Mensch und verleiht dem schleichenden Drama einen ungeahnten Spin, indem er als erklärter Klimaflüchtling für sich und seine Familie Asyl begehrt.
Ioane Teitiota, einer von 100 000 Einwohnern des aus verstreuten Atollen bestehenden Pazifikstaats Kiribati, hatte sich nach Neuseeland abgesetzt, und um sich gegen die absehbare Abschiebung zu wehren, zog er vergangenen November vor das höchste Gericht. Es gebe zu Hause „nichts für uns, keine Zukunft“, war sein schlichtes Argument. Dies sei beileibe kein Ausdruck von Unzufriedenheit mit dem abgeschiedenen Südseeinselleben, sondern beruhe auf der Erkenntnis, wie es angesichts des steigenden Wassers um das Schicksal seiner Heimat stehe.
Tatsächlich besagen die Szenarien, dass bei einem weiteren Anstieg des Meeresspiegels Kiribati in absehbarer Zeit zu existieren aufhören wird. Es besteht aus rund 30 Atollen, die zum Teil nur wenige Meter aus dem Wasser ragen. Vielleicht noch 30 Jahre werde es dauern, vermuten Forscher, dann werde den Menschen dort das Wasser im wahrsten Sinne bis zum Hals stehen.
Einige Regionen seien bereits unbewohnbar, trugen Teitiotas Anwälte vor. Ernten würden zerstört, Trinkwasser sei vielfach durch eingesickertes Meerwasser kontaminiert. Trinkwasser aber sei ein Menschenrecht. Dem mochte das Gericht allerdings nicht folgen. Zwar leide Kiribati unter dem Klimawandel, entscheidendes Kriterium für eine Anerkennung als Flüchtling im Sinn der UN-Konvention sei aber, dass Antragsteller in ihrem Heimatland Verfolgung fürchten müssten, was hier nicht der Fall sei.
Formaljuristisch ist das schwer zu bestreiten, der abschlägige Bescheid war mithin keine Überraschung. Was mit Verfolgung gemeint ist, dürfte allgemein bekannt sein. Die entsprechenden Bilder von Krieg und gewalttätigen Zuständen sind allgegenwärtig. Angesichts steigenden Wassers von Verfolgung zu reden mutet mithin nicht nur aus juristischer Sicht wie eine unangemessene Überdehnung des Wortes an, wie ein kategorialer Irrtum.
Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 103. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.
Mathias Zschaler, Jahrgang 1947, ist freier Autor in Berlin. Nach vielen Redakteursjahren bei großen deutschen Tageszeitungen schreibt er überwiegend literarisch, aber auch weiterhin journalistisch, unter anderem für Spiegel Online. Seine mare-Beiträge erschienen früher unter dem Pseudonym Benjamin Worthmann. Die Idee für diesen Essay kam ihm bei der Lektüre der Zeitungsmeldung von dem Klimaasylsuchenden Ioane Teitiota.
| Vita | Mathias Zschaler, Jahrgang 1947, ist freier Autor in Berlin. Nach vielen Redakteursjahren bei großen deutschen Tageszeitungen schreibt er überwiegend literarisch, aber auch weiterhin journalistisch, unter anderem für Spiegel Online. Seine mare-Beiträge erschienen früher unter dem Pseudonym Benjamin Worthmann. Die Idee für diesen Essay kam ihm bei der Lektüre der Zeitungsmeldung von dem Klimaasylsuchenden Ioane Teitiota. |
|---|---|
| Person | Von Mathias Zschaler |
| Vita | Mathias Zschaler, Jahrgang 1947, ist freier Autor in Berlin. Nach vielen Redakteursjahren bei großen deutschen Tageszeitungen schreibt er überwiegend literarisch, aber auch weiterhin journalistisch, unter anderem für Spiegel Online. Seine mare-Beiträge erschienen früher unter dem Pseudonym Benjamin Worthmann. Die Idee für diesen Essay kam ihm bei der Lektüre der Zeitungsmeldung von dem Klimaasylsuchenden Ioane Teitiota. |
| Person | Von Mathias Zschaler |