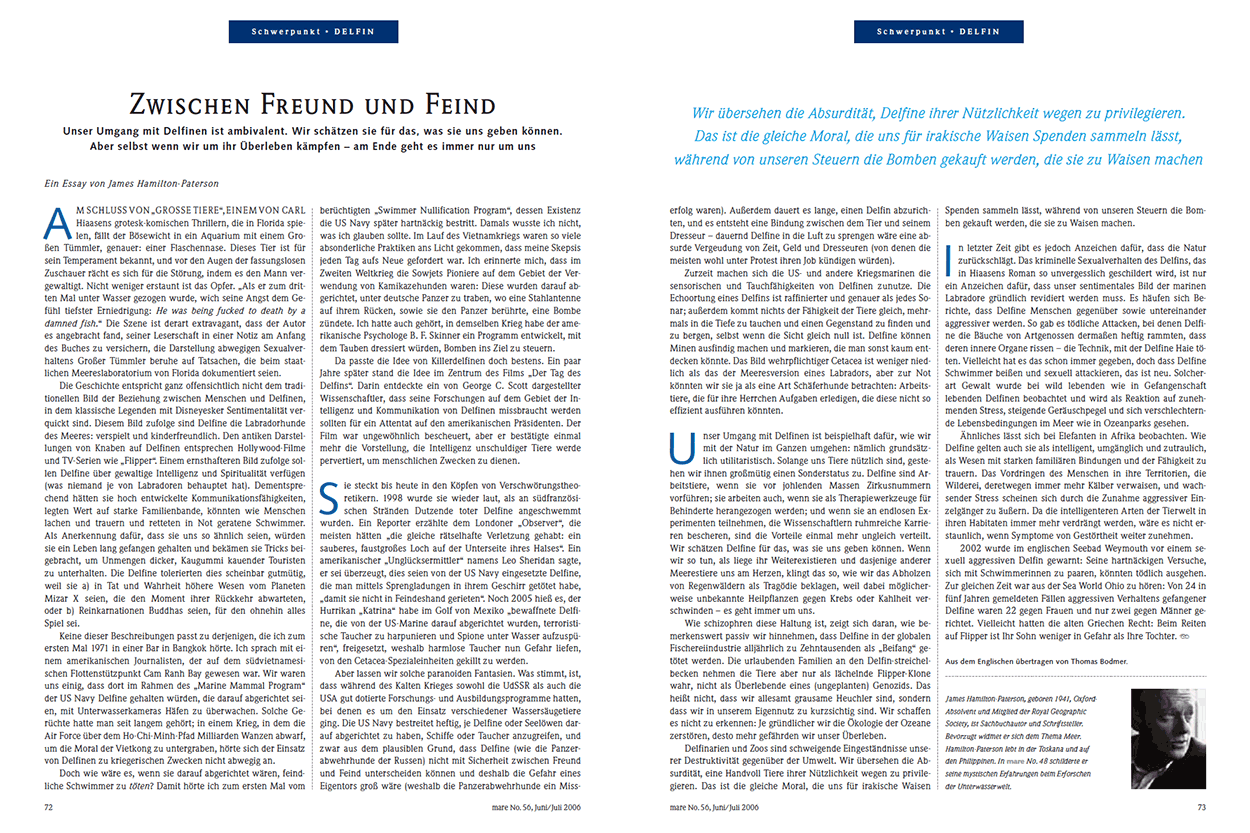Zwischen Freund und Feind
Am Schluss von „Große Tiere“, einem von Carl Hiaasens grotesk-komischen Thrillern, die in Florida spielen, fällt der Bösewicht in ein Aquarium mit einem Großen Tümmler, genauer: einer Flaschennase. Dieses Tier ist für sein Temperament bekannt, und vor den Augen der fassungslosen Zuschauer rächt es sich für die Störung, indem es den Mann vergewaltigt. Nicht weniger erstaunt ist das Opfer. „Als er zum dritten Mal unter Wasser gezogen wurde, wich seine Angst dem Gefühl tiefster Erniedrigung: He was being fucked to death by a damned fish.“ Die Szene ist derart extravagant, dass der Autor es angebracht fand, seiner Leserschaft in einer Notiz am Anfang des Buches zu versichern, die Darstellung abwegigen Sexualverhaltens Großer Tümmler beruhe auf Tatsachen, die beim staatlichen Meereslaboratorium von Florida dokumentiert seien.
Die Geschichte entspricht ganz offensichtlich nicht dem traditionellen Bild der Beziehung zwischen Menschen und Delfinen, in dem klassische Legenden mit Disneyesker Sentimentalität verquickt sind. Diesem Bild zufolge sind Delfine die Labradorhunde des Meeres: verspielt und kinderfreundlich. Den antiken Darstellungen von Knaben auf Delfinen entsprechen Hollywood-Filme und TV-Serien wie „Flipper“. Einem ernsthafteren Bild zufolge sollen Delfine über gewaltige Intelligenz und Spiritualität verfügen (was niemand je von Labradoren behauptet hat). Dementsprechend hätten sie hoch entwickelte Kommunikationsfähigkeiten, legten Wert auf starke Familienbande, könnten wie Menschen lachen und trauern und retteten in Not geratene Schwimmer. Als Anerkennung dafür, dass sie uns so ähnlich seien, würden sie ein Leben lang gefangen gehalten und bekämen sie Tricks beigebracht, um Unmengen dicker, Kaugummi kauender Touristen zu unterhalten. Die Delfine tolerierten dies scheinbar gutmütig, weil sie a) in Tat und Wahrheit höhere Wesen vom Planeten Mizar X seien, die den Moment ihrer Rückkehr abwarteten, oder b) Reinkarnationen Buddhas seien, für den ohnehin alles Spiel sei.
Keine dieser Beschreibungen passt zu derjenigen, die ich zum ersten Mal 1971 in einer Bar in Bangkok hörte. Ich sprach mit einem amerikanischen Journalisten, der auf dem südvietnamesischen Flottenstützpunkt Cam Ranh Bay gewesen war. Wir waren uns einig, dass dort im Rahmen des „Marine Mammal Program“ der US Navy Delfine gehalten würden, die darauf abgerichtet seien, mit Unterwasserkameras Häfen zu überwachen. Solche Gerüchte hatte man seit langem gehört; in einem Krieg, in dem die Air Force über dem Ho-Chi-Minh-Pfad Milliarden Wanzen abwarf, um die Moral der Vietkong zu untergraben, hörte sich der Einsatz von Delfinen zu kriegerischen Zwecken nicht abwegig an.
Doch wie wäre es, wenn sie darauf abgerichtet wären, feindliche Schwimmer zu töten? Damit hörte ich zum ersten Mal vom berüchtigten „Swimmer Nullification Program“, dessen Existenz die US Navy später hartnäckig bestritt. Damals wusste ich nicht, was ich glauben sollte. Im Lauf des Vietnamkriegs waren so viele absonderliche Praktiken ans Licht gekommen, dass meine Skepsis jeden Tag aufs Neue gefordert war. Ich erinnerte mich, dass im Zweiten Weltkrieg die Sowjets Pioniere auf dem Gebiet der Verwendung von Kamikazehunden waren: Diese wurden darauf abgerichtet, unter deutsche Panzer zu traben, wo eine Stahlantenne auf ihrem Rücken, sowie sie den Panzer berührte, eine Bombe zündete. Ich hatte auch gehört, in demselben Krieg habe der amerikanische Psychologe B. F. Skinner ein Programm entwickelt, mit dem Tauben dressiert würden, Bomben ins Ziel zu steuern.
Da passte die Idee von Killerdelfinen doch bestens. Ein paar Jahre später stand die Idee im Zentrum des Films „Der Tag des Delfins“. Darin entdeckte ein von George C. Scott dargestellter Wissenschaftler, dass seine Forschungen auf dem Gebiet der Intelligenz und Kommunikation von Delfinen missbraucht werden sollten für ein Attentat auf den amerikanischen Präsidenten. Der Film war ungewöhnlich bescheuert, aber er bestätigte einmal mehr die Vorstellung, die Intelligenz unschuldiger Tiere werde pervertiert, um menschlichen Zwecken zu dienen.
Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 56. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.
James Hamilton-Paterson, geboren 1941, Oxford-Absolvent und Mitglied der Royal Geographic Society, ist Sachbuchautor und Schriftsteller. Bevorzugt widmet er sich dem Thema Meer. Hamilton-Paterson lebt in der Toskana und auf den Philippinen. In mare No. 48 schilderte er seine mystischen Erfahrungen beim Erforschen der Unterwasserwelt.
Aus dem Englischen übertragen von Thomas Bodmer.
| Lieferstatus | Lieferbar |
|---|---|
| Vita | James Hamilton-Paterson, geboren 1941, Oxford-Absolvent und Mitglied der Royal Geographic Society, ist Sachbuchautor und Schriftsteller. Bevorzugt widmet er sich dem Thema Meer. Hamilton-Paterson lebt in der Toskana und auf den Philippinen. In mare No. 48 schilderte er seine mystischen Erfahrungen beim Erforschen der Unterwasserwelt.
Aus dem Englischen übertragen von Thomas Bodmer. |
| Person | Ein Essay von James Hamilton-Paterson |
| Lieferstatus | Lieferbar |
| Vita | James Hamilton-Paterson, geboren 1941, Oxford-Absolvent und Mitglied der Royal Geographic Society, ist Sachbuchautor und Schriftsteller. Bevorzugt widmet er sich dem Thema Meer. Hamilton-Paterson lebt in der Toskana und auf den Philippinen. In mare No. 48 schilderte er seine mystischen Erfahrungen beim Erforschen der Unterwasserwelt.
Aus dem Englischen übertragen von Thomas Bodmer. |
| Person | Ein Essay von James Hamilton-Paterson |