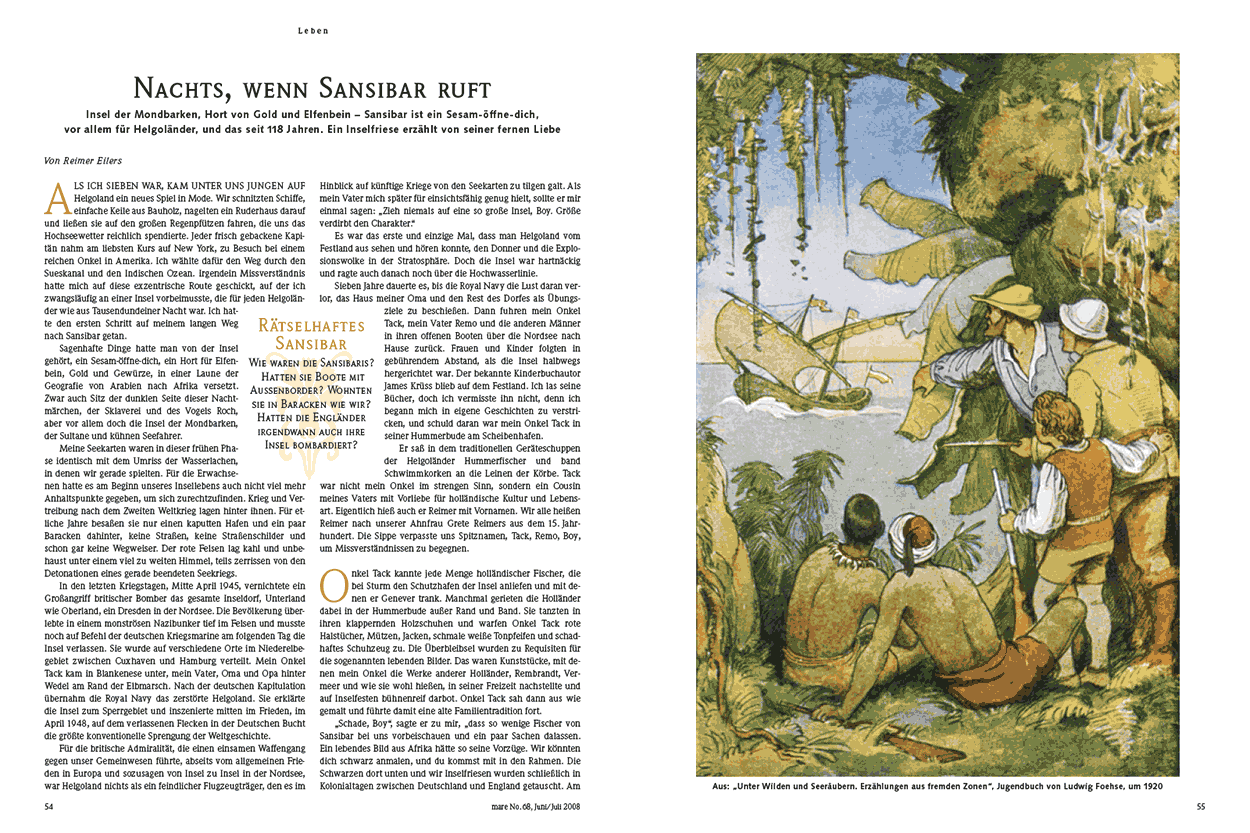Nachts, wenn Sansibar ruft
Als ich sieben war, kam unter uns Jungen auf Helgoland ein neues Spiel in Mode. Wir schnitzten Schiffe, einfache Keile aus Bauholz, nagelten ein Ruderhaus darauf und ließen sie auf den großen Regenpfützen fahren, die uns das Hochseewetter reichlich spendierte. Jeder frisch gebackene Kapitän nahm am liebsten Kurs auf New York, zu Besuch bei einem reichen Onkel in Amerika. Ich wählte dafür den Weg durch den Sueskanal und den Indischen Ozean. Irgendein Missverständnis hatte mich auf diese exzentrische Route geschickt, auf der ich zwangsläufig an einer Insel vorbeimusste, die für jeden Helgoländer wie aus Tausendundeiner Nacht war. Ich hatte den ersten Schritt auf meinem langen Weg nach Sansibar getan.
Sagenhafte Dinge hatte man von der Insel gehört, ein Sesam-öffne-dich, ein Hort für Elfenbein, Gold und Gewürze, in einer Laune der Geografie von Arabien nach Afrika versetzt. Zwar auch Sitz der dunklen Seite dieser Nachtmärchen, der Sklaverei und des Vogels Roch, aber vor allem doch die Insel der Mondbarken, der Sultane und kühnen Seefahrer.
Meine Seekarten waren in dieser frühen Phase identisch mit dem Umriss der Wasserlachen, in denen wir gerade spielten. Für die Erwachsenen hatte es am Beginn unseres Insellebens auch nicht viel mehr Anhaltspunkte gegeben, um sich zurechtzufinden. Krieg und Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg lagen hinter ihnen. Für etliche Jahre besaßen sie nur einen kaputten Hafen und ein paar Baracken dahinter, keine Straßen, keine Straßenschilder und schon gar keine Wegweiser. Der rote Felsen lag kahl und unbehaust unter einem viel zu weiten Himmel, teils zerrissen von den Detonationen eines gerade beendeten Seekriegs.
In den letzten Kriegstagen, Mitte April 1945, vernichtete ein Großangriff britischer Bomber das gesamte Inseldorf, Unterland wie Oberland, ein Dresden in der Nordsee. Die Bevölkerung überlebte in einem monströsen Nazibunker tief im Felsen und musste noch auf Befehl der deutschen Kriegsmarine am folgenden Tag die Insel verlassen. Sie wurde auf verschiedene Orte im Niederelbegebiet zwischen Cuxhaven und Hamburg verteilt. Mein Onkel Tack kam in Blankenese unter, mein Vater, Oma und Opa hinter Wedel am Rand der Elbmarsch. Nach der deutschen Kapitulation übernahm die Royal Navy das zerstörte Helgoland. Sie erklärte die Insel zum Sperrgebiet und inszenierte mitten im Frieden, im April 1948, auf dem verlassenen Flecken in der Deutschen Bucht die größte konventionelle Sprengung der Weltgeschichte.
Für die britische Admiralität, die einen einsamen Waffengang gegen unser Gemeinwesen führte, abseits vom allgemeinen Frieden in Europa und sozusagen von Insel zu Insel in der Nordsee, war Helgoland nichts als ein feindlicher Flugzeugträger, den es im Hinblick auf künftige Kriege von den Seekarten zu tilgen galt. Als mein Vater mich später für einsichtsfähig genug hielt, sollte er mir einmal sagen: „Zieh niemals auf eine so große Insel, Boy. Größe verdirbt den Charakter.“ Es war das erste und einzige Mal, dass man Helgoland vom Festland aus sehen und hören konnte, den Donner und die Explosionswolke in der Stratosphäre. Doch die Insel war hartnäckig und ragte auch danach noch über die Hochwasserlinie.
Sieben Jahre dauerte es, bis die Royal Navy die Lust daran verlor, das Haus meiner Oma und den Rest des Dorfes als Übungsziele zu beschießen. Dann fuhren mein Onkel Tack, mein Vater Remo und die anderen Männer in ihren offenen Booten über die Nordsee nach Hause zurück. Frauen und Kinder folgten in gebührendem Abstand, als die Insel halbwegs hergerichtet war. Der bekannte Kinderbuchautor James Krüss blieb auf dem Festland. Ich las seine Bücher, doch ich vermisste ihn nicht, denn ich begann mich in eigene Geschichten zu verstricken, und schuld daran war mein Onkel Tack in seiner Hummerbude am Scheibenhafen.
Er saß in dem traditionellen Geräteschuppen der Helgoländer Hummerfischer und band Schwimmkorken an die Leinen der Körbe. Tack war nicht mein Onkel im strengen Sinn, sondern ein Cousin meines Vaters mit Vorliebe für holländische Kultur und Lebensart. Eigentlich hieß auch er Reimer mit Vornamen. Wir alle heißen Reimer nach unserer Ahnfrau Grete Reimers aus dem 15. Jahrhundert. Die Sippe verpasste uns Spitznamen, Tack, Remo, Boy, um Missverständnissen zu begegnen.
Onkel Tack kannte jede Menge holländischer Fischer, die bei Sturm den Schutzhafen der Insel anliefen und mit denen er Genever trank. Manchmal gerieten die Holländer dabei in der Hummerbude außer Rand und Band. Sie tanzten in ihren klappernden Holzschuhen und warfen Onkel Tack rote Halstücher, Mützen, Jacken, schmale weiße Tonpfeifen und schadhaftes Schuhzeug zu. Die Überbleibsel wurden zu Requisiten für die sogenannten lebenden Bilder. Das waren Kunststücke, mit denen mein Onkel die Werke anderer Holländer, Rembrandt, Vermeer und wie sie wohl hießen, in seiner Freizeit nachstellte und auf Inselfesten bühnenreif darbot. Onkel Tack sah dann aus wie gemalt und führte damit eine alte Familientradition fort. „Schade, Boy“, sagte er zu mir, „dass so wenige Fischer von Sansibar bei uns vorbeischauen und ein paar Sachen dalassen. Ein lebendes Bild aus Afrika hätte so seine Vorzüge. Wir könnten dich schwarz anmalen, und du kommst mit in den Rahmen. Die Schwarzen dort unten und wir Inselfriesen wurden schließlich in Kolonialtagen zwischen Deutschland und England getauscht. Am 10. August 1890 kam Wilhelm auf unsere Insel, weißt du wohl? Nächsten Sommer soll es an dem Gedenktag wieder das Bootsrennen auf der Reede geben. Das ist Vorkriegstradition, und ein lebendes Bild würde die Feier abrunden.“
Allerdings, so richtig getauscht wurden Helgoland und Sansibar eigentlich nicht, denn Sansibar war nie eine deutsche Kolonie und konnte deshalb auch nicht getauscht werden. In dem „Vertrag zwischen Deutschland und England über die Kolonien und Helgoland“ ordneten die Mächte ihre Einflussgebiete: Die Deutschen verzichteten auf Ansprüche in Ostafrika und bekamen im Gegenzug das bis dahin von den Briten regierte Helgoland.
Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 68. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.
Der Schriftsteller Reimer Eilers, geboren 1955 in Casablanca, erhielt das Visum für seine letzte Sansibar-Reise vom Honorarkonsul der Republik Tansania, Jürgen Gotthardt, in den „Mokkastuben“ auf Helgoland.
| Vita | Der Schriftsteller Reimer Eilers, geboren 1955 in Casablanca, erhielt das Visum für seine letzte Sansibar-Reise vom Honorarkonsul der Republik Tansania, Jürgen Gotthardt, in den „Mokkastuben“ auf Helgoland. |
|---|---|
| Person | Von Reimer Eilers |
| Vita | Der Schriftsteller Reimer Eilers, geboren 1955 in Casablanca, erhielt das Visum für seine letzte Sansibar-Reise vom Honorarkonsul der Republik Tansania, Jürgen Gotthardt, in den „Mokkastuben“ auf Helgoland. |
| Person | Von Reimer Eilers |