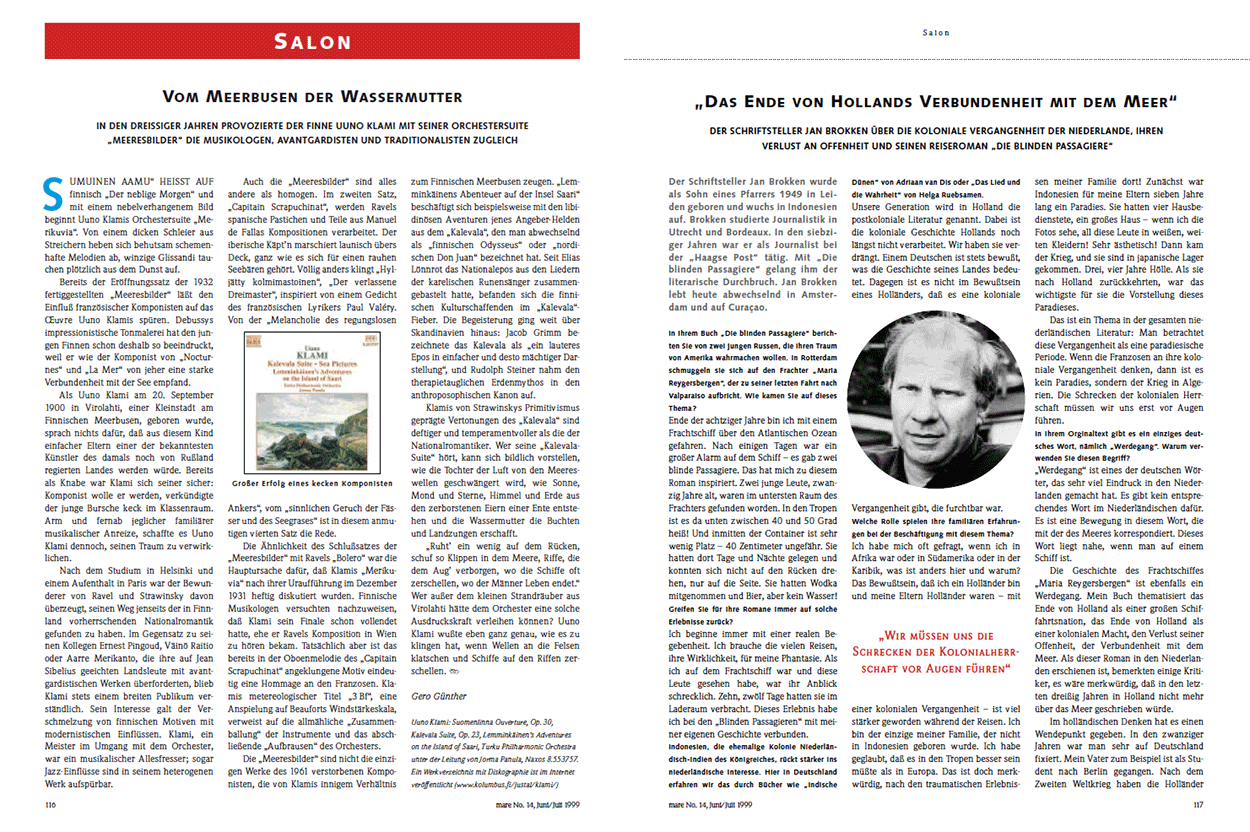mare-Salon
Vom Meerbusen der Wassermutter
In den dreißiger Jahren provozierte der Finne Uuno Klami mit seiner Orchestersuite „Meeresbilder“ die Musikologen, Avantgardisten und Traditionalisten zugleich
Sumuinen aamu“ heisst auf finnisch „Der neblige Morgen“ und mit einem nebelverhangenem Bild beginnt Uuno Klamis Orchestersuite „Merikuvia“. Von einem dicken Schleier aus Streichern heben sich behutsam schemenhafte Melodien ab, winzige Glissandi tauchen plötzlich aus dem Dunst auf.
Bereits der Eröffnungssatz der 1932 fertiggestellten „Meeresbilder“ läßt den Einfluß französischer Komponisten auf das Œuvre Uuno Klamis spüren. Debussys impressionistische Tonmalerei hat den jungen Finnen schon deshalb so beeindruckt, weil er wie der Komponist von „Nocturnes“ und „La Mer“ von jeher eine starke Verbundenheit mit der See empfand.
Als Uuno Klami am 20. September 1900 in Virolahti, einer Kleinstadt am Finnischen Meerbusen, geboren wurde, sprach nichts dafür, daß aus diesem Kind einfacher Eltern einer der bekanntesten Künstler des damals noch von Rußland regierten Landes werden würde. Bereits als Knabe war Klami sich seiner sicher: Komponist wolle er werden, verkündigte der junge Bursche keck im Klassenraum. Arm und fernab jeglicher familiärer musikalischer Anreize, schaffte es Uuno Klami dennoch, seinen Traum zu verwirklichen.
Nach dem Studium in Helsinki und einem Aufenthalt in Paris war der Bewunderer von Ravel und Strawinsky davon überzeugt, seinen Weg jenseits der in Finnland vorherrschenden Nationalromantik gefunden zu haben. Im Gegensatz zu seinen Kollegen Ernest Pingoud, Väinö Raitio oder Aarre Merikanto, die ihre auf Jean Sibelius geeichten Landsleute mit avantgardistischen Werken überforderten, blieb Klami stets einem breiten Publikum verständlich. Sein Interesse galt der Verschmelzung von finnischen Motiven mit modernistischen Einflüssen. Klami, ein Meister im Umgang mit dem Orchester, war ein musikalischer Allesfresser; sogar Jazz-Einflüsse sind in seinem heterogenen Werk aufspürbar.
Auch die „Meeresbilder“ sind alles andere als homogen. Im zweiten Satz, „Capitain Scrapuchinat“, werden Ravels spanische Pastichen und Teile aus Manuel de Fallas Kompositionen verarbeitet. Der iberische Käpt’n marschiert launisch übers Deck, ganz wie es sich für einen rauhen Seebären gehört. Völlig anders klingt „Hyljätty kolmimastoinen“, „Der verlassene Dreimaster“, inspiriert von einem Gedicht des französischen Lyrikers Paul Valéry. Von der „Melancholie des regungslosen Ankers“, vom „sinnlichen Geruch der Fässer und des Seegrases“ ist in diesem anmutigen vierten Satz die Rede.
Die Ähnlichkeit des Schlußsatzes der „Meeresbilder“ mit Ravels „Bolero“ war die Hauptursache dafür, daß Klamis „Merikuvia“ nach ihrer Uraufführung im Dezember 1931 heftig diskutiert wurden. Finnische Musikologen versuchten nachzuweisen, daß Klami sein Finale schon vollendet hatte, ehe er Ravels Komposition in Wien zu hören bekam. Tatsächlich aber ist das bereits in der Oboenmelodie des „Capitain Scrapuchinat“ angeklungene Motiv eindeutig eine Hommage an den Franzosen. Klamis metereologischer Titel „3 Bf“, eine Anspielung auf Beauforts Windstärkeskala, verweist auf die allmähliche „Zusammenballung“ der Instrumente und das abschließende „Aufbrausen“ des Orchesters.
Die „Meeresbilder“ sind nicht die einzigen Werke des 1961 verstorbenen Komponisten, die von Klamis innigem Verhältnis zum Finnischen Meerbusen zeugen. „Lemminkäinens Abenteuer auf der Insel Saari“ beschäftigt sich beispielsweise mit den libidinösen Aventuren jenes Angeber-Helden aus dem „Kalevala“, den man abwechselnd als „finnischen Odysseus“ oder „nordischen Don Juan“ bezeichnet hat. Seit Elias Lönnrot das Nationalepos aus den Liedern der karelischen Runensänger zusammengebastelt hatte, befanden sich die finnischen Kulturschaffenden im „Kalevala“-Fieber. Die Begeisterung ging weit über Skandinavien hinaus: Jacob Grimm bezeichnete das Kalevala als „ein lauteres Epos in einfacher und desto mächtiger Darstellung“, und Rudolph Steiner nahm den therapietauglichen Erdenmythos in den anthroposophischen Kanon auf.
Klamis von Strawinskys Primitivismus geprägte Vertonungen des „Kalevala“ sind deftiger und temperamentvoller als die der Nationalromantiker. Wer seine „Kalevala-Suite“ hört, kann sich bildlich vorstellen, wie die Tochter der Luft von den Meereswellen geschwängert wird, wie Sonne, Mond und Sterne, Himmel und Erde aus den zerborstenen Eiern einer Ente entstehen und die Wassermutter die Buchten und Landzungen erschafft.
„Ruht’ ein wenig auf dem Rücken, schuf so Klippen in dem Meere, Riffe, die dem Aug’ verborgen, wo die Schiffe oft zerschellen, wo der Männer Leben endet.“ Wer außer dem kleinen Strandräuber aus Virolahti hätte dem Orchester eine solche Ausdruckskraft verleihen können? Uuno Klami wußte eben ganz genau, wie es zu klingen hat, wenn Wellen an die Felsen klatschen und Schiffe auf den Riffen zerschellen. Gero Günther
Uuno Klami: Suomenlinna Ouverture, Op. 30, Kalevala Suite, Op. 23, Lemminkäinen’s Adventures on the Island of Saari, Turku Philharmonic Orchestra unter der Leitung von Jorma Panula, Naxos 8.553757. Ein Werkverzeichnis mit Diskographie ist im Internet veröffentlicht (www.kolumbus.fi/justal/klami/)
„Das Ende von Hollands Verbundenheit mit dem Meer“
Der Schriftsteller Jan Brokken über die koloniale Vergangenheit der Niederlande, ihren Verlust an Offenheit und seinen Reiseroman „Die blinden Passagiere“
Der Schriftsteller Jan Brokken wurde als Sohn eines Pfarrers 1949 in Leiden geboren und wuchs in Indonesien auf. Brokken studierte Journalistik in Utrecht und Bordeaux. In den siebziger Jahren war er als Journalist bei der „Haagse Post“ tätig. Mit „Die blinden Passagiere“ gelang ihm der literarische Durchbruch. Jan Brokken lebt heute abwechselnd in Amsterdam und auf Curaçao.
In Ihrem Buch „Die blinden Passagiere“ berichten Sie von zwei jungen Russen, die ihren Traum von Amerika wahrmachen wollen. In Rotterdam schmuggeln sie sich auf den Frachter „Maria Reygersbergen“, der zu seiner letzten Fahrt nach Valparaiso aufbricht. Wie kamen Sie auf dieses Thema?
Ende der achtziger Jahre bin ich mit einem Frachtschiff über den Atlantischen Ozean gefahren. Nach einigen Tagen war ein großer Alarm auf dem Schiff – es gab zwei blinde Passagiere. Das hat mich zu diesem Roman inspiriert. Zwei junge Leute, zwanzig Jahre alt, waren im untersten Raum des Frachters gefunden worden. In den Tropen ist es da unten zwischen 40 und 50 Grad heiß! Und inmitten der Container ist sehr wenig Platz – 40 Zentimeter ungefähr. Sie hatten dort Tage und Nächte gelegen und konnten sich nicht auf den Rücken drehen, nur auf die Seite. Sie hatten Wodka mitgenommen und Bier, aber kein Wasser!
Greifen Sie für Ihre Romane immer auf solche Erlebnisse zurück?
Ich beginne immer mit einer realen Begebenheit. Ich brauche die vielen Reisen, ihre Wirklichkeit, für meine Phantasie. Als ich auf dem Frachtschiff war und diese Leute gesehen habe, war ihr Anblick schrecklich. Zehn, zwölf Tage hatten sie im Laderaum verbracht. Dieses Erlebnis habe ich bei den „Blinden Passagieren“ mit meiner eigenen Geschichte verbunden.
Indonesien, die ehemalige Kolonie Niederländisch-Indien des Königreiches, rückt stärker ins niederländische Interesse. Hier in Deutschland erfahren wir das durch Bücher wie „Indische Dünen“ von Adriaan van Dis oder „Das Lied und die Wahrheit“ von Helga Ruebsamen.
Unsere Generation wird in Holland die postkoloniale Literatur genannt. Dabei ist die koloniale Geschichte Hollands noch längst nicht verarbeitet. Wir haben sie verdrängt. Einem Deutschen ist stets bewußt, was die Geschichte seines Landes bedeutet. Dagegen ist es nicht im Bewußtsein eines Holländers, daß es eine koloniale Vergangenheit gibt, die furchtbar war.
Welche Rolle spielen Ihre familiären Erfahrungen bei der Beschäftigung mit diesem Thema?
Ich habe mich oft gefragt, wenn ich in Afrika war oder in Südamerika oder in der Karibik, was ist anders hier und warum? Das Bewußtsein, daß ich ein Holländer bin und meine Eltern Holländer waren – mit einer kolonialen Vergangenheit – ist viel stärker geworden während der Reisen. Ich bin der einzige meiner Familie, der nicht in Indonesien geboren wurde. Ich habe geglaubt, daß es in den Tropen besser sein müßte als in Europa. Das ist doch merkwürdig, nach den traumatischen Erlebnissen meiner Familie dort! Zunächst war Indonesien für meine Eltern sieben Jahre lang ein Paradies. Sie hatten vier Hausbedienstete, ein großes Haus – wenn ich die Fotos sehe, all diese Leute in weißen, weiten Kleidern! Sehr ästhetisch! Dann kam der Krieg, und sie sind in japanische Lager gekommen. Drei, vier Jahre Hölle. Als sie nach Holland zurückkehrten, war das wichtigste für sie die Vorstellung dieses Paradieses.
Das ist ein Thema in der gesamten niederländischen Literatur: Man betrachtet diese Vergangenheit als eine paradiesische Periode. Wenn die Franzosen an ihre koloniale Vergangenheit denken, dann ist es kein Paradies, sondern der Krieg in Algerien. Die Schrecken der kolonialen Herrschaft müssen wir uns erst vor Augen führen.
In Ihrem Orginaltext gibt es ein einziges deutsches Wort, nämlich „Werdegang“. Warum verwenden Sie diesen Begriff?
„Werdegang“ ist eines der deutschen Wörter, das sehr viel Eindruck in den Niederlanden gemacht hat. Es gibt kein entsprechendes Wort im Niederländischen dafür. Es ist eine Bewegung in diesem Wort, die mit der des Meeres korrespondiert. Dieses Wort liegt nahe, wenn man auf einem Schiff ist.
Die Geschichte des Frachtschiffes „Maria Reygersbergen“ ist ebenfalls ein Werdegang. Mein Buch thematisiert das Ende von Holland als einer großen Schiffahrtsnation, das Ende von Holland als einer kolonialen Macht, den Verlust seiner Offenheit, der Verbundenheit mit dem Meer. Als dieser Roman in den Niederlanden erschienen ist, bemerkten einige Kritiker, es wäre merkwürdig, daß in den letzten dreißig Jahren in Holland nicht mehr über das Meer geschrieben würde.
Im holländischen Denken hat es einen Wendepunkt gegeben. In den zwanziger Jahren war man sehr auf Deutschland fixiert. Mein Vater zum Beispiel ist als Student nach Berlin gegangen. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Holländer zunächst nach Frankreich geschaut und dann nach England, in die USA. Der Zweite Weltkrieg bedeutete auch einen Bruch mit der Kolonialzeit, der Seefahrt. Man meinte, daß alles, was in unserer Geschichte mit der Seefahrt zu tun hat, höchstens noch für Jugendbücher und Abenteuergeschichten gut sei. Dabei muß man sich das vorstellen: Die Holländer waren einmal ein Volk von anderthalb Millionen Menschen, die drei Viertel der Weltmeere unter Kontrolle hatten! Das ist unglaublich. Außer Portugal hat kein Land in Europa eine solche Vergangenheit. Warum sollte man das vergessen? Ich wollte die Verbundenheit mit dem Meer wieder zur Sprache bringen.
Neben den beiden Russen sind Maurice und Adriana die einzigen Passagiere des Schiffes; der Rest ist Besatzung. Die Gegenwart des Frachters und der Hauptfiguren ist beladen mit einer krisenreichen Vergangenheit. Sind die Figuren auf einer Reise in ihre eigene Vergangenheit?
Es ist unmöglich, frei zu reisen. Das ist ein romantisches Ideal, daß, wenn man fortgeht, man alles hinter sich lassen könne. Wir nehmen immer unsere Vergangenheit mit. In Afrika sagte mir ein alter Mann: „Das Auge des Reisenden ist groß. Aber er sieht nichts.“
Sie beschreiben das Fremde auffallend nüchtern. Den treffenden Ausdruck für Ihre Sichtweise geben die Sätze: „Was man nicht sieht, weiß man nicht – da gibt es nichts dran zu rütteln. Es ist eine logische Sprache, die Sprache des Meeres.“
In den holländischen Gemälden ist es zum Beispiel so: Das erste, was man an einem Vermeer sieht, ist dieses wunderschöne Blau! Und das zweite ist: diese Gesichter, diese Frauen, diese Melancholie! Auf den Gemälden von Vermeer lesen die Frauen immer einen Brief. Wenn man diese Gemälde besser kennt, sieht man eine ganze Geschichte in diesen Briefen und eine ganze Philosophie in diesem Bild. Der Maler entfaltet es jedoch nicht als eine Idee. Das Entscheidende ist das, was man sieht. Ich glaube, in der Literatur ist es dasselbe.
Interview: Volkmar Mühleis
Jan Brokken: „Die blinden Passagiere“, Roman, Paul Szolnay Verlag, Wien 1998, 413 Seiten, 39,80 Mark
Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 14. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.
| Vita | mare-Kulturredaktion |
|---|---|
| Person | mare-Kulturredaktion |
| Vita | mare-Kulturredaktion |
| Person | mare-Kulturredaktion |