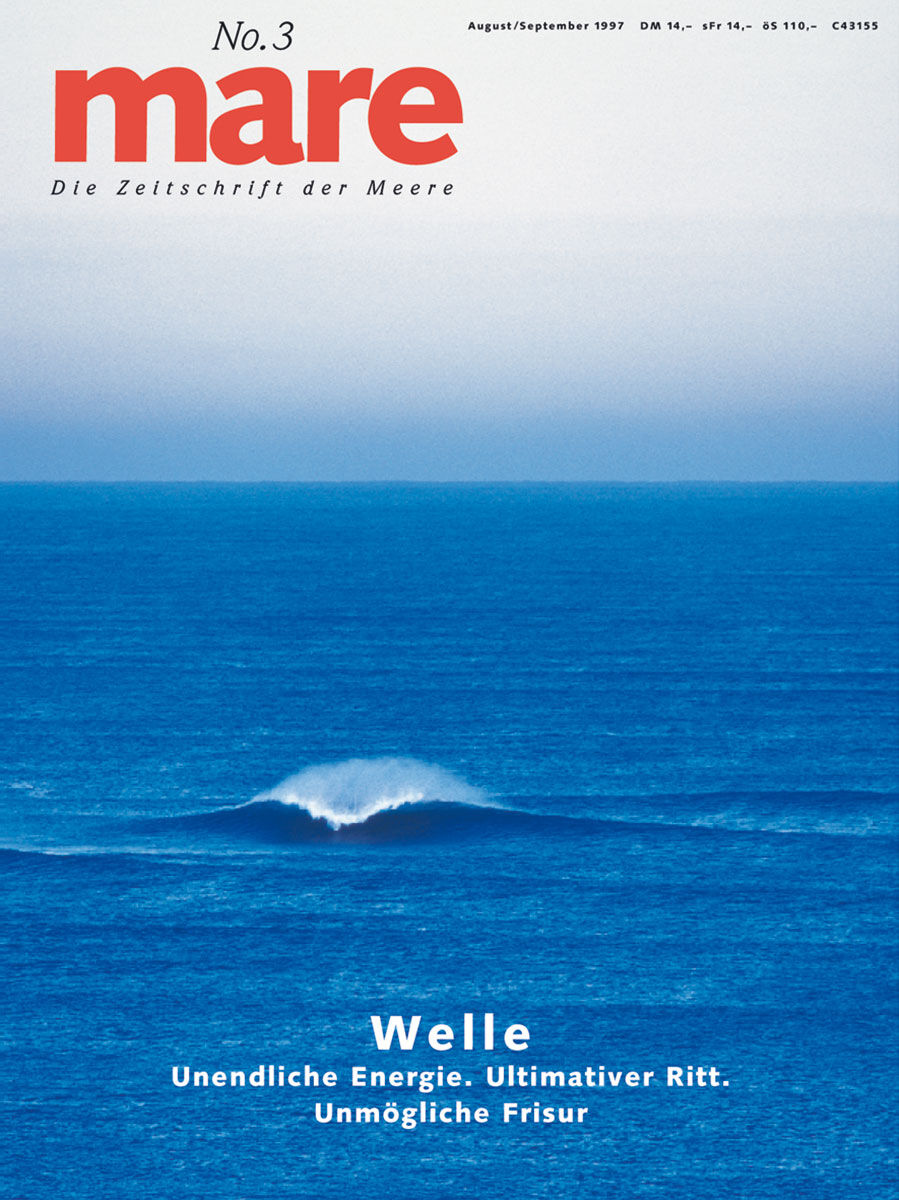„Leuchtfeuer“ in der Ostsee
Mulmige Stimmung früh am Morgen an Deck der „Pommern“: Stumm sitzen die Fischer in der Kabine des Kutters, trinken schwarzen Kaffee und verzehren mitgebrachte Butterbrote. Über Funk trudeln die neuesten Wettermeldungen ein. Die Besatzung – Vater, drei Söhne und ein weiteres Mitglied der Fischereigenossenschaft „Leuchtfeuer“ – ist sich an diesem Tag überhaupt nicht „grün“. Vor Tagesanbruch gab es im Hafen von Thiessow lautstarken Streit. Vater und ältester Sohn gerieten heftig aneinander, weil der „Alte“ es für unsinnig hielt, nach zwei Tagen Sturm, bei Windstärke sechs und kabbeliger See schon wieder hinaus auf die Ostsee zu fahren.
„Bei dem Wind können wir doch nicht raus, in den Reusen ist doch kein Hering drin“, winkte Martin Pretzel verärgert im Halbdunkeln ab. „Ach was, wir müssen heute raus. Allein schon wegen der Netze, die müssen instand gesetzt werden“, herrschte ihn sein ältester Sohn Ferdinand auf der Brücke an. Nur mürrisch lenkte Martin schließlich ein: „Gut, mach’ was du willst, fahren wir!“ Auch der Erfahrenere weiß nur zu gut, dass in der Hochsaison jeder Tag zählt, an dem der „Brotfisch“ an Land gezogen wird.
Grau zieht eine Wolkendecke an diesem bitterkalten Maitag über den Greifswalder Bodden, südlich der Insel Rügen. Im Schlepptau schlingern drei Ruderboote im Kielwasser der „Pommern“. Rund zehn Seemeilen legen Vater und seine drei Söhne zurück, fahren am unbewohnten Eiland Ruden vorbei, bis im dichten Nebel die ersten Konturen ihrer „besten Reuse“ auftauchen. Weiter südlich ist die Küstenlinie von Usedom zu erkennen.
Kormorane steigen kreischend empor, als die Heringsfischer ankern und eilig in ihre Auslegboote springen. Mit kräftigen Ruderschlägen nähern sie sich den Netzen, die an langen Holzpfählen hängen. „Sieht nicht so schlimm aus“, unterbricht der jüngste der drei Söhne die archaische Ruhe, die nur vom Klatschen des Wassers gegen die schaukelnden Bootsplanken unterlegt wird. Die Gereiztheit scheint verflogen, als das Familienquartett beginnt, die sturmgeschädigte Reuse zu reparieren. Die Rollen sind klar verteilt, jeder Griff sitzt, und kräftige Hände tauchen ins eiskalte Wasser, packen Tampen, ziehen, zerren und zurren am komplizierten Tau- und Netzwerk.
Seit Jahrhunderten stellen die Küstenbewohner zwischen Stralsund und der Odermündung Reusen und Stellnetze auf. Von der Hansezeit bis zur realsozialistischen Periode gingen Fischer wie die Pretzels mit ihren ausgeklügelten Methoden, gereift und entwickelt aus den Erfahrungen ganzer Generationen, ihrem Handwerk nach. Bis zur deutschen Einheit gab es so etwas wie eine fanghistorische Kontinuität. Im Zuge der „sanften Revolution“ von 1989 fand allerdings ein tiefer Bruch statt. Seitdem stirbt die einstige Küstenfischerei. Wenn die Entwicklung so weiterläuft – dann wohl für immer. Schon jetzt fahren nur noch wenige wie die Thiessower Fischer auf ihren Schiffen und Booten hinaus. Viele der zu DDR-Zeiten gegründeten kleinen Genossenschaften haben bereits vor den durchaus „eigenen“ Gesetzen der Marktwirtschaft frustriert kapituliert. Gingen in den achtziger Jahren noch über 1700 Insulaner auf Fang, so sind es heute nur noch rund 250. Tendenz weiter abnehmend.
Das hat viele Ursachen. Die genügsame, manchmal selbstherrliche Mentalität des stolzen Inselfischers widerspricht alertem, kaufmännischem Denken, das sich in erster Linie mit dem Verkauf identifiziert und den Gewinn als die Maxime des Handelns sieht. Sicherlich mangelt es vielen an unternehmerischem Mut, an der Risikobereitschaft eines Martin Pretzel. Der hat ein schwindelerregendes Darlehen aufgenommen, informierte sich, nahm EU-Gelder in Anspruch und kaufte die elf Meter lange eiserne „Pommern“. Mehr als eine Million blätterte er für das mit moderner Navigation ausgerüstete Motorschiff hin. Dafür fischen die Mitglieder von „Leuchtfeuer“ aber wesentlich mehr als ihre Kollegen im Nachbardorf Klein Zicker, die nur mit Ruderbooten ausgerüstet sind. Diese hieven im Gegensatz zu den Pretzels ihren Fang noch per Hand ins Boot.
Wolfgang Struck aus Klein Zicker gibt im stilechten Mecklenburger Platt unumwunden zu: „We könt moken, wat wie wulln, we könt nich so veel rinholn wie de Pretzels.“ Unterschwellig schwingt schon Zweifel mit, ob die Entscheidung vor einigen Jahren, sich nicht zu modernisieren, tatsächlich richtig war. „We malocht und kregt een krumme Ruch und weten nich, ob we davun lebn künt“, schildert der 48jährige die Situation, während er im kleinen Bauwagen die spärlichen Einkünfte im abgegriffenen Kontobuch der Genossenschaft überfliegt.
Der Kauf eines Motorkutters war für Struck wie für viele andere Berufskollegen undenkbar, hatten sie doch in der DDR, in die sich einige verklärt zurücksehnen, ein gesichertes Auskommen. Sie fischten die hoch subventionierten Staatsquoten locker ab, und nebenher gingen die „fischenden Lokalfürsten“ auf lukrativen Privatfang – nach Lust und Laune.
Angesichts des chronischen Warenmangels im ostdeutschen Sozialismus hatten sie immer gute Karten bei den Gästen der beliebten Urlaubsinsel. Aber nicht nur auf der Insel, auch weit ab von der Küste standen sich die Fischer gut. „In der Honecker-Ära war der Rügener Aal wie ’ne Währung. Ich tauschte im Ludwigsfelder Lkw-Werk Aal gegen Ersatzteile, damit wir unseren W 50 wieder flottkriegen konnten: Es gab doch nichts mehr am Ende der 80er Jahre“, erinnert sich Martin Pretzel.
Diese Zeiten sind allerdings Geschichte. Denn das einstige Fischkombinat, das den Inselfischern eine ständige Abnahme ihrer Fische garantierte, ist inzwischen „kaputtsaniert worden“, wie viele Rüganer schimpfen: Die meisten Schiffe der früheren Flotte wurden verhökert oder verschrottet. Plötzlich pfiff den Insulanern scharfer Westwind um die Ohren: Viele fühlten sich überrannt, regelrecht ausgenommen von den Wessis, die nach dem Mauerfall allerlei Hehres versprachen und später als Wende-Raubritter durch vermeintlich „blühende Landschaften“ zogen. Die Realität war und ist nach wie vor eine andere. Kein Wunder also, dass die anfängliche, zumal kritikunfähige Euphorie mehr und mehr einem Lamento wich, das Eigeninitiative gänzlich erstarren ließ. Zu teuer, nicht kalkulierbar und überhaupt zu ungewiss erschien alles Neue. Arbeitslosigkeit folgte, was viele zur Schnapsflasche trieb. Ulrich Kliesow, Geschäftsführer der Fischereigenossenschaft Seedorf, bei der von ursprünglich 43 Fischern gegenwärtig nur noch sieben ihre Reusen auswerfen, spitzt frustriert zu: „Das ist der Aufschwung Ost.“
Der junge Stellnetzfischer Mario Mundt aus Baabe prognostiziert düstere Aussichten: „Wenn hier nicht bald was geschieht, dann wohnt hier in vierzig Jahren keiner mehr.“ Dabei wirkt die soziokulturelle Erosion an Land bis weit unter den Meeresspiegel. Zwar wandert der Hering noch jedes Jahr in riesigen Schwärmen zum Laichen in die flache Pommersche Bucht. Doch wird er empfindlich bei der Fortpflanzung gestört, wenn statt der aussterbenden Küstenfischer die großen, PS-starken Schiffe das Geschäft übernehmen. Eine rabiate Jagd, die mit gewaltigen Schlepp- und Grundnetzen ein gigantisches Verbrechen nicht nur an den Fischen, sondern am ganzen Ökosystem Meer verübt.
Eine holländische Firma beabsichtigt, 50000 bis 100000 Tonnen Heringe mit eigenen Trawlern zu fangen, und diese Mengen in einem neuen, eigenen Fischwerk in Saßnitz zu be- und verarbeiten. Wann und ob das Werk tatsächlich errichtet wird, weiß bis dato keiner so recht. Angesichts eines bestehenden Dosenwerks, das rund 20 Prozent des deutschen Fischdosenmarktes bedient, ohnehin ein kurioses Unterfangen. Dennoch spricht sich das Ministerium für Landwirtschaft und Fischerei in Schwerin nicht grundsätzlich gegen eine solche ausländische Investition aus. Denn der Investor chartert auch gleich eine komplette Fangflotte, die spielend die derzeitigen Fangmengen, die weit unter denen der DDR-Zeiten liegen, übertreffen wird.
Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 3. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.
Dierk Jensen, aufgewachsen auf der Insel Pellworm, lebt als freier Autor in Hamburg.
Fotograf Jörg Böthling fuhr mehrere Jahre als Matrose zur See. Autor und Fotograf sind Mitglieder von agenda
| Vita | Dierk Jensen, aufgewachsen auf der Insel Pellworm, lebt als freier Autor in Hamburg.
Fotograf Jörg Böthling fuhr mehrere Jahre als Matrose zur See. Autor und Fotograf sind Mitglieder von agenda |
|---|---|
| Person | Von Dierk Jensen und Jörg Böthling |
| Vita | Dierk Jensen, aufgewachsen auf der Insel Pellworm, lebt als freier Autor in Hamburg.
Fotograf Jörg Böthling fuhr mehrere Jahre als Matrose zur See. Autor und Fotograf sind Mitglieder von agenda |
| Person | Von Dierk Jensen und Jörg Böthling |