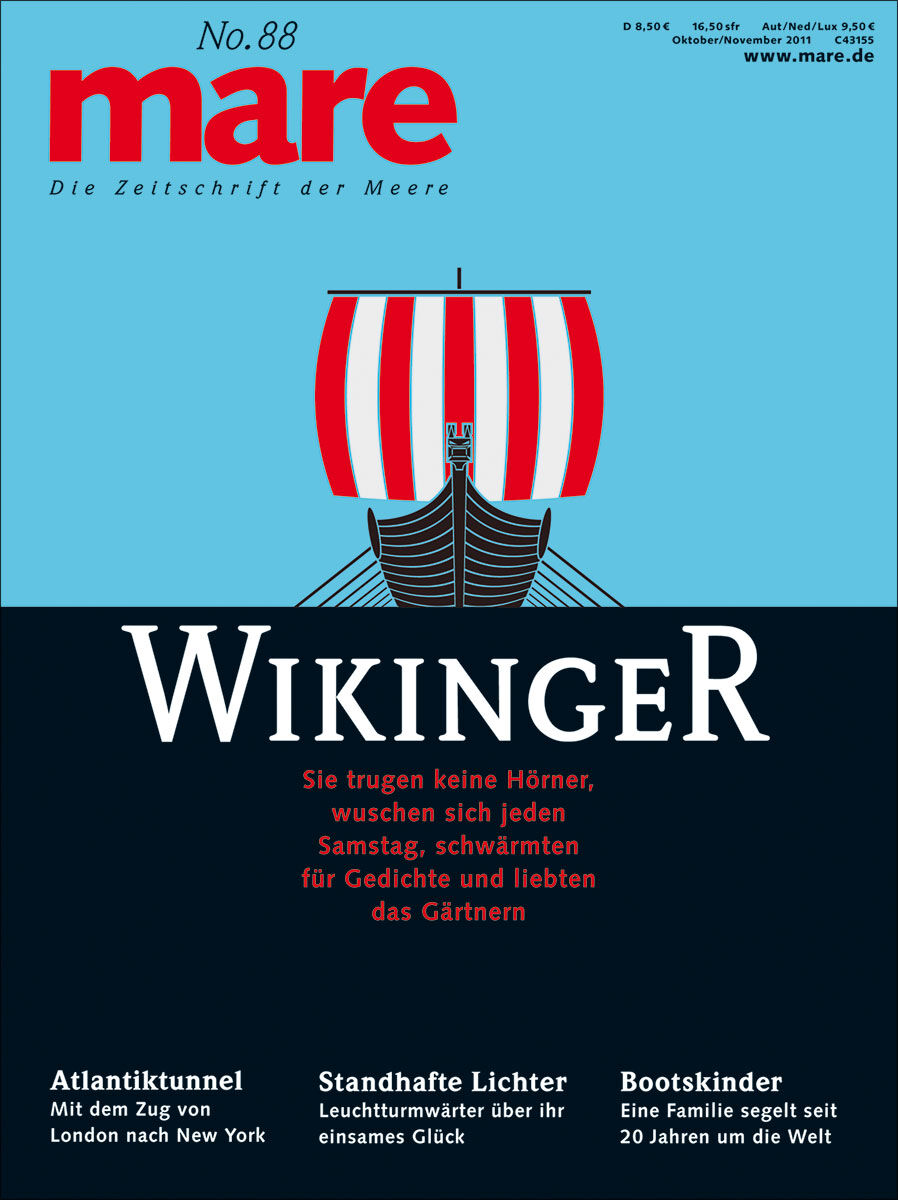Kreuzen im Theatermeer
Sie sind Parallelwelten, in denen verschwenderischer Luxus und enge Maschinenräume, schwindelerregende Arbeitsplätze und goldverzierte Aufgänge nahe beieinander liegen. Während die einen über große Freitreppen zu ihren stuckierten Logen flanieren, halten die anderen in den Maschinenräumen und an den Seilzügen das Schiff am Laufen.
Die Rede ist nicht von den großen Transatlantikdampfern der vorhergehenden Jahrhundertwende, sondern von den Theaterpalästen in der Mitte unserer Städte. Die Ähnlichkeit zwischen der Seefahrt auf den Meeren und den Kreuzern der Fantasie ist frappierend, und sie geht über architektonische Gemeinsamkeiten hinaus.
Schon allein diese sind bei genauerem Hinsehen groß. Das hat nicht nur damit zu tun, dass viele Theater zu einer Zeit gebaut worden sind, in der eine Klassengesellschaft und ein auf Repräsentation bedachtes Bürgertum noch allgegenwärtig waren. Die Ähnlichkeit zwischen den großen Theaterkreuzern und den Dampfern jener Jahrhundertwende beruht vielmehr auf einem Funktionalismus, der sich erst beim zweiten Blick erschließt.
Beide logieren Menschenmassen. Das Deutsche Schauspielhaus in Hamburg verfügte bei seiner Eröffnung im Jahr 1900 über mehr Sitzplätze, als die „Titanic“ auf ihrer Jungfernfahrt Passagiere an Bord hatte. Und diese zahlenden Gäste wollten nicht bloß untergebracht, sondern unterhalten und bespielt werden. Kurz: Der Aufenthalt an Bord eines Theaters sollte sich in vielerlei Hinsicht lohnen.
Ein wichtiges Movens ist die ureigenste gesellschaftliche Lust an der Repräsentation. Wenn sich auf dem engen Raum eines Schiffes oder eben eines Theaterhauses zu einer Premiere oder
einer Jungfernfahrt ein Spiegelbild der Herrschenden und Mächtigen versammelt, um von den weniger Mächtigen bestaunt zu werden, braucht es dafür natürlich besondere Kulissen. Prunkvolle Säle, großzügige Foyers und vielleicht sogar ein Balkon vor der Oper, von dem man auf die Stadt hinuntergucken kann, finden sich selbst in modernen Theaterneubauten. Wer am Abend an ihnen entlanggeht, hört dann leise die Musik über den Kai oder den Theatervorplatz hinüberwehen und fragt sich, wie es wohl zugeht bei denen, die an Bord sind.
Das Ziel der großen Dampfer ist oft unerheblich; die Reise zählt, nicht nur in der Seefahrt. Denn auch wenn es in einem Theater nicht von A nach B geht, kommt der Zuschauer doch im Idealfall wie nach einer aufregenden Überfahrt als jemand anders wieder heraus, als er das Gebäude betreten hat. Geboten werden – neben der Auseinandersetzung mit unserer Wirklichkeit – auch im Theater von heute Eindrücke ferner Länder, Illusionen und Exotik, der Blick in eine fremde Welt, mit der die die Bühnen umgebende Alltagssphäre wenig bis nichts zu tun hat.
Analogien wie diese treffen nicht nur auf das Publikum, sondern auch die Crew, die Besatzung der Dampfer selbst zu. Es gibt wohl außerhalb der Seefahrt und des Militärs keine andere Organisation in der Welt, die so hierarchisch aufgebaut ist und so sehr auf Befehl und Gehorsam beruht wie der Kosmos eines Staatstheaters. Nicht umsonst werden scheidende Intendanten in München mit Kapitänen verglichen. Und in den Verträgen der Mächtigen findet man viel mehr aus einem Kapitänspatent der Royal Navy aus dem 18. Jahrhundert als aus dem Arbeitsvertrag einer modernen Führungskraft. Auch ein Intendant erhält ein Kommando, einen meist auf fünf Jahre begrenzten Auftrag, mit dem er mit seiner Crew auf Kaperfahrt oder Schatzsuche geht. Nicht Gold und Glitter winken, sondern künstlerischer Ruhm und Aufmerksamkeit.
Wer gut ist, bekommt immer wieder ein Kommando, wer schlecht ist oder vom Pech verfolgt, muss sich als Kapitän ohne Schiff an Land verdingen, aber was ist ein Intendant ohne ein Haus? Seiner Crew geht es nicht anders. Jeder Theaterleiter stellt nach Gutdünken sein Team zusammen, seine Dramaturgen, die wie die Offiziere die größte Macht nach dem Intendanten haben. Und die Schauspieler werden zusammengesucht aus alten Bekannten, nicht aus einsamen Hafenschenken, sondern aus dem übervollen Pool fähiger Leute. Es ist eine Crew auf Zeit, die sich mit dem Ende einer Intendanz, wenn alle zurück an Land gehen, auflöst wie eine Schiffsbesatzung, die ihre Reise beendet hat. Und oft genug gleich zu neuen Abenteuern aufbricht.
Der künstlerischen Besatzung steht an Bord jedes Theaters das Heer der Bühnentechniker zur Seite, die unabhängig von den großen Plänen der Offiziersriege ihren Job machen. Im 18. Jahrhundert waren die Arbeiter in den englischen Theaterhäusern häufig abgemusterte Seeleute. Nur sie konnten sich an diesen Orten sicher bewegen, in denen Seilzüge, schmale Stiegen und Kräne zum Alltag gehörten. Und wer heute die Bühne eines großen Hauses besichtigt und beobachtet, wie Beleuchter und Techniker eine Inszenierung einrichten, Seilzüge belegen, Prospekte und Rundhorizonte spannen, der fühlt sich nicht nur an die Arbeit auf einem Clipper erinnert. Spätestens, wenn die Bühnenpodien wie in einem Containerterminal urplötzlich versinken oder nach oben fahren, gesteuert von einem Computersystem, erkennt man, dass auch von der modernen Seefahrt manches in den Stellwarten und Bühnenbrücken zu finden ist.
Es blühen in der Einsamkeit der Bühnen offenbar auch die gleichen menschlichen Laster wie in der alten und neuen Seefahrt. In der Royal Navy hatte noch bis 1970 jeder Seemann das Recht auf ein tägliches Quantum Rum. Im Theater gilt das Privileg von Alkohol am Arbeitsplatz bis heute. Alkoholismus ist ein Berufsproblem, erklären Dramaturgen hinter vorgehaltener Hand. Gerade unter den größten von ihnen finden sich etliche, die trinken, weil sie anders die Gefahren und Ängste, vor allem die Einsamkeit ihres Berufs nicht ertragen. So wie Kapitäne auf See immer Abstand zu ihrer Crew halten müssen, im Angesicht der Gefahr selten ihre wahren Gefühle zeigen können und gerade wegen ihrer absoluten Macht die einsamsten Menschen an Bord sind, sind auch Regisseure als Anführer ihrer Truppe nicht selten die Einsamsten in der Crew.
Wenn sich die Spielenden nach der Probe zusammenfinden und gemeinsam das Erlebte verdauen und versaufen, wenn vielleicht einer von ihnen, der lieber selbst Kapitän wäre, die anderen von der Unfähigkeit des Alten zu überzeugen sucht, wenn all die Techniker, Beleuchter und Handwerker kopfschüttelnd Feierabend machen, weil wieder einmal nichts funktioniert hat, sitzt der Spielleiter allein in seiner Kajüte und überlegt, wie er den künstlerischen Gibraltar-Durchbruch wohl schaffen könnte, am nächsten Tag, wenn wieder alle pünktlich auf der Probe auf ein Wort aus seinem Mund warten.
In den Kantinen erzählt man sich die Geschichten von Regisseuren, die ihre Entdeckungsreisen nur mit ausreichend Rotwein unter Deck beginnen. Wie etwa die eines großen Trinkers und noch größeren Shakespeare-Entdeckers, der gleich einer Figur aus Stevensons „Schatzinsel“ heimatlos über die Theatermeere geistert und im Vollrausch überraschende Orte auf dem „siebten Kontinent“ entdeckt. Der immer wieder an den Ängsten, die dieser Beruf mit sich bringt, zu scheitern droht und doch jedes Mal mit voller Beute, die kein Zuschauer je gesehen hat, den Premierenhafen erreicht. Aber auch die Schauspieler sind gefährdet in einer Arbeitswelt, in der der Exzess Teil des Alltags ist. Sie müssen bei der Premiere ihr Gesicht in den Wind halten und Entrüstung oder Verzückung des Publikums ertragen, während der Kapitän, vom Sturm der Elemente geschützt, sicher in der Kantine sitzt.
Überhaupt die Kantinen. Sie sind legendäre Orte, an denen sich gleich den Hafenbars des vorletzten Jahrhunderts Bühnenarbeiter, Matrosen, Kommandanten und Regisseure, ja sogar Intendanten und Admirale treffen, um auszuhandeln, wohin die nächste Reise geht. Hier blühen sie, die Geschichten von zukünftigen Plänen und vergangenen Taten, die immer größer werden, je öfter man sie erzählt. Hier spinnt man auch das Seemannsgarn der großen Regielegenden, der Zadeks, der Reinhardts, der Schlingensiefs, Namen, die so ehrfürchtig gehandelt werden wie einst die von Admiral Nelson, Klaus Störtebeker oder Stevensons Kapitän Flint.
Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 88. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.
Alexander Kohlmann, Jahrgang 1978, bereist die Meere der Welt und die Ozeane der Fantasie. Er studierte Medienwissenschaft, Geschichte und Theaterregie und ist Publizist, Regisseur und Segler. Die Idee einer Verknüpfung von Seemannsgarn und Theatergeschichten entstand in zahlreichen Gesprächen mit seiner langjährigen Lektorin und Freundin Stella Diedrich, Mitarbeiterin im Berliner Alexander Verlag.
| Vita | Alexander Kohlmann, Jahrgang 1978, bereist die Meere der Welt und die Ozeane der Fantasie. Er studierte Medienwissenschaft, Geschichte und Theaterregie und ist Publizist, Regisseur und Segler. Die Idee einer Verknüpfung von Seemannsgarn und Theatergeschichten entstand in zahlreichen Gesprächen mit seiner langjährigen Lektorin und Freundin Stella Diedrich, Mitarbeiterin im Berliner Alexander Verlag. |
|---|---|
| Person | Von Alexander Kohlmann |
| Vita | Alexander Kohlmann, Jahrgang 1978, bereist die Meere der Welt und die Ozeane der Fantasie. Er studierte Medienwissenschaft, Geschichte und Theaterregie und ist Publizist, Regisseur und Segler. Die Idee einer Verknüpfung von Seemannsgarn und Theatergeschichten entstand in zahlreichen Gesprächen mit seiner langjährigen Lektorin und Freundin Stella Diedrich, Mitarbeiterin im Berliner Alexander Verlag. |
| Person | Von Alexander Kohlmann |