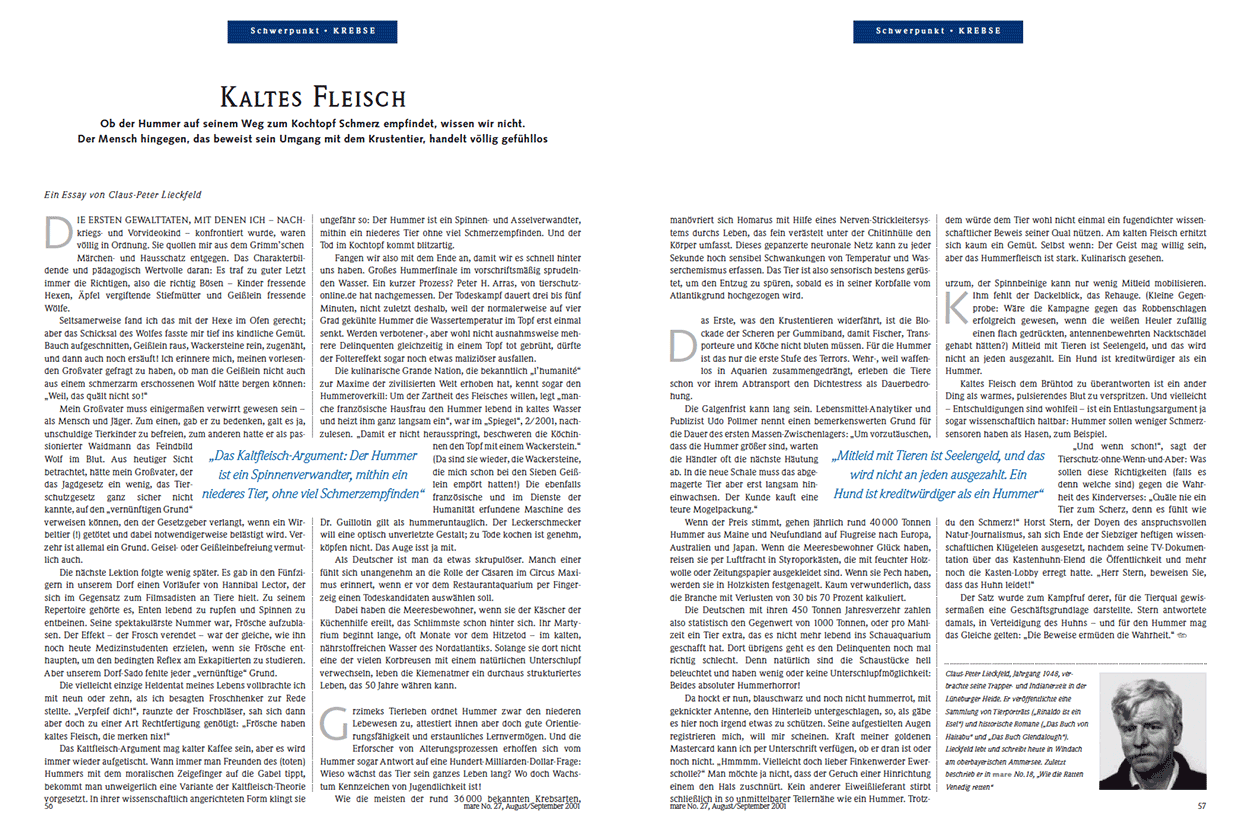Kaltes Fleisch
Die ersten Gewalttaten, mit denen ich – Nachkriegs- und Vorvideokind – konfrontiert wurde, waren völlig in Ordnung. Sie quollen mir aus dem Grimm’schen Märchen- und Hausschatz entgegen. Das Charakterbildende und pädagogisch Wertvolle daran: Es traf zu guter Letzt immer die Richtigen, also die richtig Bösen – Kinder fressende Hexen, Äpfel vergiftende Stiefmütter und Geißlein fressende Wölfe.
Seltsamerweise fand ich das mit der Hexe im Ofen gerecht; aber das Schicksal des Wolfes fasste mir tief ins kindliche Gemüt. Bauch aufgeschnitten, Geißlein raus, Wackersteine rein, zugenäht, und dann auch noch ersäuft! Ich erinnere mich, meinen vorlesenden Großvater gefragt zu haben, ob man die Geißlein nicht auch aus einem schmerzarm erschossenen Wolf hätte bergen können: „Weil, das quält nicht so!“
Mein Großvater muss einigermaßen verwirrt gewesen sein – als Mensch und Jäger. Zum einen, gab er zu bedenken, galt es ja, unschuldige Tierkinder zu befreien, zum anderen hatte er als passionierter Waidmann das Feindbild Wolf im Blut. Aus heutiger Sicht betrachtet, hätte mein Großvater, der das Jagdgesetz ein wenig, das Tierschutzgesetz ganz sicher nicht kannte, auf den „vernünftigen Grund“ verweisen können, den der Gesetzgeber verlangt, wenn ein Wirbeltier (!) getötet und dabei notwendigerweise belästigt wird. Verzehr ist allemal ein Grund. Geisel- oder Geißleinbefreiung vermutlich auch.
Die nächste Lektion folgte wenig später. Es gab in den Fünfzigern in unserem Dorf einen Vorläufer von Hannibal Lector, der sich im Gegensatz zum Filmsadisten an Tiere hielt. Zu seinem Repertoire gehörte es, Enten lebend zu rupfen und Spinnen zu entbeinen. Seine spektakulärste Nummer war, Frösche aufzublasen. Der Effekt – der Frosch verendet – war der gleiche, wie ihn noch heute Medizinstudenten erzielen, wenn sie Frösche enthaupten, um den bedingten Reflex am Exkapitierten zu studieren. Aber unserem Dorf-Sado fehlte jeder „vernünftige“ Grund.
Die vielleicht einzige Heldentat meines Lebens vollbrachte ich mit neun oder zehn, als ich besagten Froschhenker zur Rede stellte. „Verpfeif dich!“, raunzte der Froschbläser, sah sich dann aber doch zu einer Art Rechtfertigung genötigt: „Frösche haben kaltes Fleisch, die merken nix!“
Das Kaltfleisch-Argument mag kalter Kaffee sein, aber es wird immer wieder aufgetischt. Wann immer man Freunden des (toten) Hummers mit dem moralischen Zeigefinger auf die Gabel tippt, bekommt man unweigerlich eine Variante der Kaltfleisch-Theorie vorgesetzt. In ihrer wissenschaftlich angerichteten Form klingt sie ungefähr so: Der Hummer ist ein Spinnen- und Asselverwandter, mithin ein niederes Tier ohne viel Schmerzempfinden. Und der Tod im Kochtopf kommt blitzartig.
Fangen wir also mit dem Ende an, damit wir es schnell hinter uns haben. Großes Hummerfinale im vorschriftsmäßig sprudelnden Wasser. Ein kurzer Prozess? Peter H. Arras, von tierschutz-online.de hat nachgemessen. Der Todeskampf dauert drei bis fünf Minuten, nicht zuletzt deshalb, weil der normalerweise auf vier Grad gekühlte Hummer die Wassertemperatur im Topf erst einmal senkt. Werden verbotener-, aber wohl nicht ausnahmsweise mehrere Delinquenten gleichzeitig in einem Topf tot gebrüht, dürfte der Foltereffekt sogar noch etwas maliziöser ausfallen.
Die kulinarische Grande Nation, die bekanntlich „l’humanité“ zur Maxime der zivilisierten Welt erhoben hat, kennt sogar den Hummeroverkill: Um der Zartheit des Fleisches willen, legt „manche französische Hausfrau den Hummer lebend in kaltes Wasser und heizt ihm ganz langsam ein“, war im „Spiegel“, 2/2001, nachzulesen. „Damit er nicht herausspringt, beschweren die Köchinnen den Topf mit einem Wackerstein.“ (Da sind sie wieder, die Wackersteine, die mich schon bei den Sieben Geißlein empört hatten!) Die ebenfalls französische und im Dienste der Humanität erfundene Maschine des Dr. Guillotin gilt als hummeruntauglich. Der Leckerschmecker will eine optisch unverletzte Gestalt; zu Tode kochen ist genehm, köpfen nicht. Das Auge isst ja mit.
Als Deutscher ist man da etwas skrupulöser. Manch einer fühlt sich unangenehm an die Rolle der Cäsaren im Circus Maximus erinnert, wenn er vor dem Restaurantaquarium per Fingerzeig einen Todeskandidaten auswählen soll.
Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 27. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.
Claus-Peter Lieckfeld, Jahrgang 1948, verbrachte seine Trapper- und Indianerzeit in der Lüneburger Heide. Er veröffentlichte eine Sammlung von Tierporträts (Rinaldo ist ein Esel) und historische Romane (Das Buch von Haitabu und Das Buch Glendalough). Lieckfeld lebt und schreibt heute in Windach am oberbayerischen Ammersee. Zuletzt beschrieb er in mare No. 18, Wie die Ratten Venedig retten
| Vita | Claus-Peter Lieckfeld, Jahrgang 1948, verbrachte seine Trapper- und Indianerzeit in der Lüneburger Heide. Er veröffentlichte eine Sammlung von Tierporträts (Rinaldo ist ein Esel) und historische Romane (Das Buch von Haitabu und Das Buch Glendalough). Lieckfeld lebt und schreibt heute in Windach am oberbayerischen Ammersee. Zuletzt beschrieb er in mare No. 18, Wie die Ratten Venedig retten |
|---|---|
| Person | Ein Essay von Claus-Peter Lieckfeld |
| Vita | Claus-Peter Lieckfeld, Jahrgang 1948, verbrachte seine Trapper- und Indianerzeit in der Lüneburger Heide. Er veröffentlichte eine Sammlung von Tierporträts (Rinaldo ist ein Esel) und historische Romane (Das Buch von Haitabu und Das Buch Glendalough). Lieckfeld lebt und schreibt heute in Windach am oberbayerischen Ammersee. Zuletzt beschrieb er in mare No. 18, Wie die Ratten Venedig retten |
| Person | Ein Essay von Claus-Peter Lieckfeld |