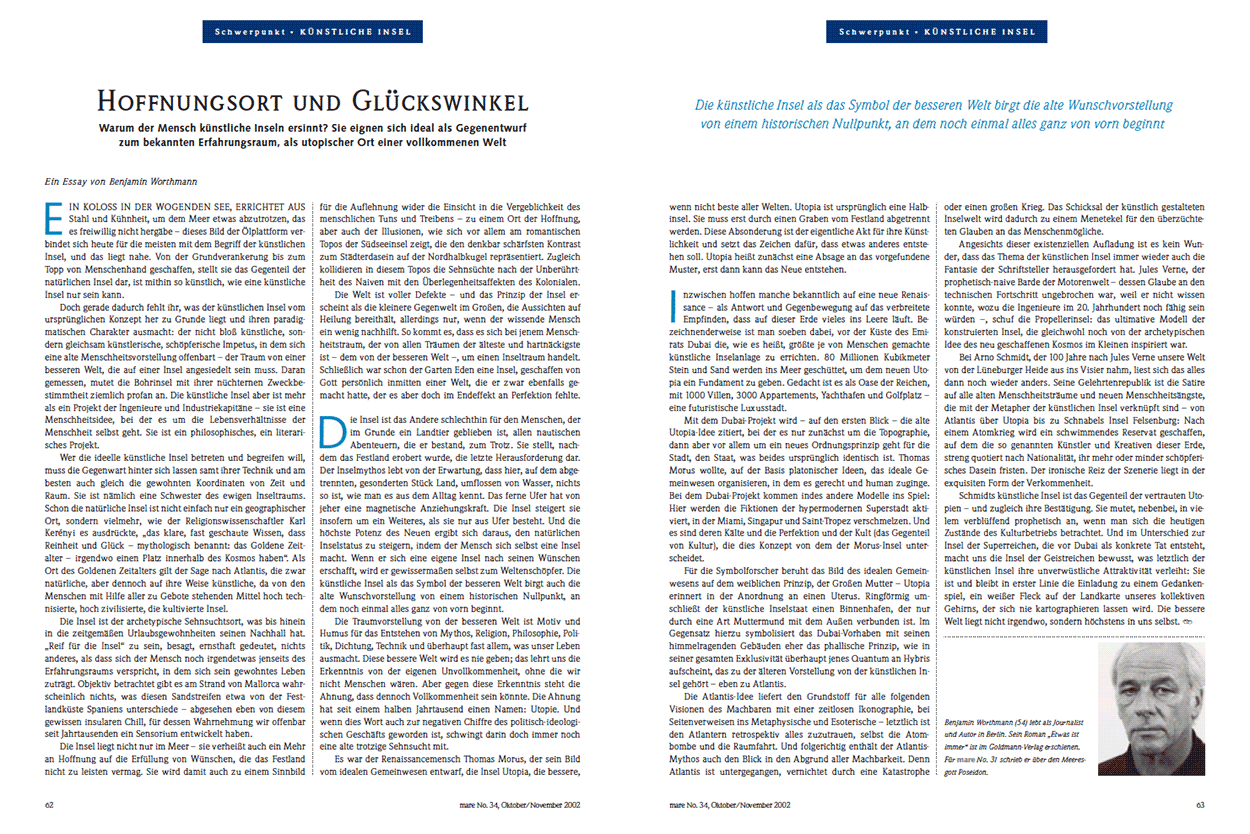Hoffnungsort und Glückswinkel
Ein Koloss in der wogenden See, errichtet aus Stahl und Kühnheit, um dem Meer etwas abzutrotzen, das es freiwillig nicht hergäbe – dieses Bild der Ölplattform verbindet sich heute für die meisten mit dem Begriff der künstlichen Insel, und das liegt nahe. Von der Grundverankerung bis zum Topp von Menschenhand geschaffen, stellt sie das Gegenteil der natürlichen Insel dar, ist mithin so künstlich, wie eine künstliche Insel nur sein kann.
Doch gerade dadurch fehlt ihr, was der künstlichen Insel vom ursprünglichen Konzept her zu Grunde liegt und ihren paradigmatischen Charakter ausmacht: der nicht bloß künstliche, sondern gleichsam künstlerische, schöpferische Impetus, in dem sich eine alte Menschheitsvorstellung offenbart – der Traum von einer besseren Welt, die auf einer Insel angesiedelt sein muss. Daran gemessen, mutet die Bohrinsel mit ihrer nüchternen Zweckbestimmtheit ziemlich profan an. Die künstliche Insel aber ist mehr als ein Projekt der Ingenieure und Industriekapitäne – sie ist eine Menschheitsidee, bei der es um die Lebensverhältnisse der Menschheit selbst geht. Sie ist ein philosophisches, ein literarisches Projekt.
Wer die ideelle künstliche Insel betreten und begreifen will, muss die Gegenwart hinter sich lassen samt ihrer Technik und am besten auch gleich die gewohnten Koordinaten von Zeit und Raum. Sie ist nämlich eine Schwester des ewigen Inseltraums. Schon die natürliche Insel ist nicht einfach nur ein geographischer Ort, sondern vielmehr, wie der Religionswissenschaftler Karl Kerényi es ausdrückte, „das klare, fast geschaute Wissen, dass Reinheit und Glück – mythologisch benannt: das Goldene Zeitalter – irgendwo einen Platz innerhalb des Kosmos haben“. Als Ort des Goldenen Zeitalters gilt der Sage nach Atlantis, die zwar natürliche, aber dennoch auf ihre Weise künstliche, da von den Menschen mit Hilfe aller zu Gebote stehenden Mittel hoch technisierte, hoch zivilisierte, die kultivierte Insel.
Die Insel ist der archetypische Sehnsuchtsort, was bis hinein in die zeitgemäßen Urlaubsgewohnheiten seinen Nachhall hat. „Reif für die Insel“ zu sein, besagt, ernsthaft gedeutet, nichts anderes, als dass sich der Mensch noch irgendetwas jenseits des Erfahrungsraums verspricht, in dem sich sein gewohntes Leben zuträgt. Objektiv betrachtet gibt es am Strand von Mallorca wahrscheinlich nichts, was diesen Sandstreifen etwa von der Festlandküste Spaniens unterschiede – abgesehen eben von diesem gewissen insularen Chill, für dessen Wahrnehmung wir offenbar seit Jahrtausenden ein Sensorium entwickelt haben.
Die Insel liegt nicht nur im Meer – sie verheißt auch ein Mehr an Hoffnung auf die Erfüllung von Wünschen, die das Festland nicht zu leisten vermag. Sie wird damit auch zu einem Sinnbild für die Auflehnung wider die Einsicht in die Vergeblichkeit des menschlichen Tuns und Treibens – zu einem Ort der Hoffnung, aber auch der Illusionen, wie sich vor allem am romantischen Topos der Südseeinsel zeigt, die den denkbar schärfsten Kontrast zum Städterdasein auf der Nordhalbkugel repräsentiert. Zugleich kollidieren in diesem Topos die Sehnsüchte nach der Unberührtheit des Naiven mit den Überlegenheitsaffekten des Kolonialen.
Die Welt ist voller Defekte – und das Prinzip der Insel erscheint als die kleinere Gegenwelt im Großen, die Aussichten auf Heilung bereithält, allerdings nur, wenn der wissende Mensch ein wenig nachhilft. So kommt es, dass es sich bei jenem Menschheitstraum, der von allen Träumen der älteste und hartnäckigste ist – dem von der besseren Welt –, um einen Inseltraum handelt. Schließlich war schon der Garten Eden eine Insel, geschaffen von Gott persönlich inmitten einer Welt, die er zwar ebenfalls gemacht hatte, der es aber doch im Endeffekt an Perfektion fehlte.
Die Insel ist das Andere schlechthin für den Menschen, der im Grunde ein Landtier geblieben ist, allen nautischen Abenteuern, die er bestand, zum Trotz. Sie stellt, nachdem das Festland erobert wurde, die letzte Herausforderung dar. Der Inselmythos lebt von der Erwartung, dass hier, auf dem abgetrennten, gesonderten Stück Land, umflossen von Wasser, nichts so ist, wie man es aus dem Alltag kennt. Das ferne Ufer hat von jeher eine magnetische Anziehungskraft. Die Insel steigert sie insofern um ein Weiteres, als sie nur aus Ufer besteht. Und die höchste Potenz des Neuen ergibt sich daraus, den natürlichen Inselstatus zu steigern, indem der Mensch sich selbst eine Insel macht. Wenn er sich eine eigene Insel nach seinen Wünschen erschafft, wird er gewissermaßen selbst zum Weltenschöpfer. Die künstliche Insel als das Symbol der besseren Welt birgt auch die alte Wunschvorstellung von einem historischen Nullpunkt, an dem noch einmal alles ganz von vorn beginnt.
Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 34. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.
| Vita | Benjamin Worthmann lebt als Journalist und Autor in Berlin. Sein Roman Etwas ist immer ist im Goldmann-Verlag erschienen. Für mare No. 31 schrieb er über den Meeresgott Poseidon. |
|---|---|
| Person | Ein Essay von Benjamin Worthmann |
| Vita | Benjamin Worthmann lebt als Journalist und Autor in Berlin. Sein Roman Etwas ist immer ist im Goldmann-Verlag erschienen. Für mare No. 31 schrieb er über den Meeresgott Poseidon. |
| Person | Ein Essay von Benjamin Worthmann |