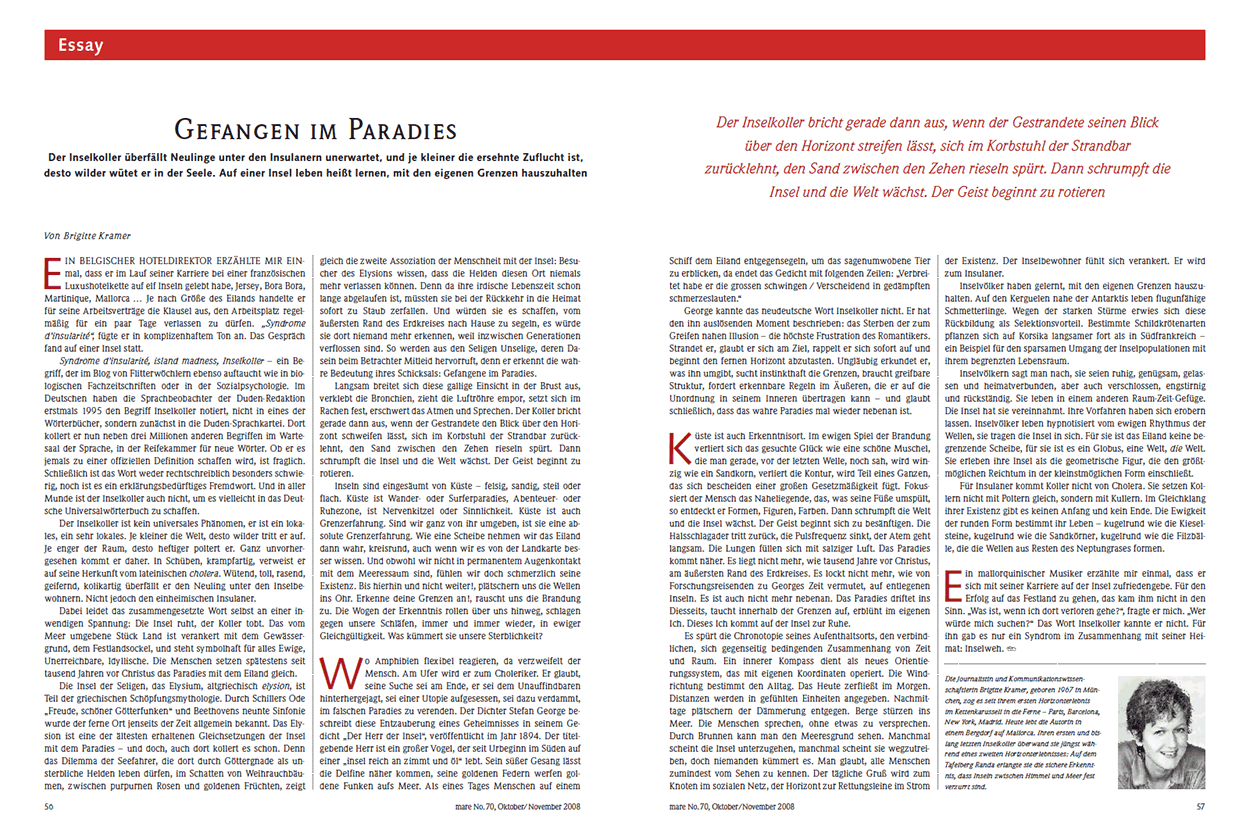Gefangen im Paradies
Ein belgischer Hoteldirektor erzählte mir einmal, dass er im Lauf seiner Karriere bei einer französischen Luxushotelkette auf elf Inseln gelebt habe, Jersey, Bora Bora, Martinique, Mallorca … Je nach Größe des Eilands handelte er für seine Arbeitsverträge die Klausel aus, den Arbeitsplatz regelmäßig für ein paar Tage verlassen zu dürfen. „Syndrome d’insularité“, fügte er in komplizenhaftem Ton an. Das Gespräch fand auf einer Insel statt.
Syndrome d’insularité, island madness, Inselkoller – ein Begriff, der im Blog von Flitterwöchlern ebenso auftaucht wie in biologischen Fachzeitschriften oder in der Sozialpsychologie. Im Deutschen haben die Sprachbeobachter der Duden-Redaktion erstmals 1995 den Begriff Inselkoller notiert, nicht in eines der Wörterbücher, sondern zunächst in die Duden-Sprachkartei. Dort kollert er nun neben drei Millionen anderen Begriffen im Wartesaal der Sprache, in der Reifekammer für neue Wörter. Ob er es jemals zu einer offiziellen Definition schaffen wird, ist fraglich. Schließlich ist das Wort weder rechtschreiblich besonders schwierig, noch ist es ein erklärungsbedürftiges Fremdwort. Und in aller Munde ist der Inselkoller auch nicht, um es vielleicht in das Deutsche Universalwörterbuch zu schaffen. Der Inselkoller ist kein universales Phänomen, er ist ein lokales, ein sehr lokales. Je kleiner die Welt, desto wilder tritt er auf. Je enger der Raum, desto heftiger poltert er. Ganz unvorhergesehen kommt er daher. In Schüben, krampfartig, verweist er auf seine Herkunft vom lateinischen cholera. Wütend, toll, rasend, geifernd, kolikartig überfällt er den Neuling unter den Inselbewohnern. Nicht jedoch den einheimischen Insulaner.
Dabei leidet das zusammengesetzte Wort selbst an einer inwendigen Spannung: Die Insel ruht, der Koller tobt. Das vom Meer umgebene Stück Land ist verankert mit dem Gewässergrund, dem Festlandsockel, und steht symbolhaft für alles Ewige, Unerreichbare, Idyllische. Die Menschen setzen spätestens seit tausend Jahren vor Christus das Paradies mit dem Eiland gleich.
Die Insel der Seligen, das Elysium, altgriechisch elysion, ist Teil der griechischen Schöpfungsmythologie. Durch Schillers Ode „Freude, schöner Götterfunken“ und Beethovens Neunte Sinfonie wurde der ferne Ort jenseits der Zeit allgemein bekannt. Das Elysion ist eine der ältesten erhaltenen Gleichsetzungen der Insel mit dem Paradies – und doch, auch dort kollert es schon. Denn das Dilemma der Seefahrer, die dort durch Göttergnade als unsterbliche Helden leben dürfen, im Schatten von Weihrauchbäumen, zwischen purpurnen Rosen und goldenen Früchten, zeigt gleich die zweite Assoziation der Menschheit mit der Insel: Besucher des Elysions wissen, dass die Helden diesen Ort niemals mehr verlassen können. Denn da ihre irdische Lebenszeit schon lange abgelaufen ist, müssten sie bei der Rückkehr in die Heimat sofort zu Staub zerfallen. Und würden sie es schaffen, vom äußersten Rand des Erdkreises nach Hause zu segeln, es würde sie dort niemand mehr erkennen, weil inzwischen Generationen verflossen sind. So werden aus den Seligen Unselige, deren Dasein beim Betrachter Mitleid hervorruft, denn er erkennt die wahre Bedeutung ihres Schicksals: Gefangene im Paradies.
Langsam breitet sich diese gallige Einsicht in der Brust aus, verklebt die Bronchien, zieht die Luftröhre empor, setzt sich im Rachen fest, erschwert das Atmen und Sprechen. Der Koller bricht gerade dann aus, wenn der Gestrandete den Blick über den Horizont schweifen lässt, sich im Korbstuhl der Strandbar zurücklehnt, den Sand zwischen den Zehen rieseln spürt. Dann schrumpft die Insel und die Welt wächst. Der Geist beginnt zu rotieren.
Inseln sind eingesäumt von Küste – felsig, sandig, steil oder flach. Küste ist Wander- oder Surferparadies, Abenteuer- oder Ruhezone, ist Nervenkitzel oder Sinnlichkeit. Küste ist auch Grenzerfahrung. Sind wir ganz von ihr umgeben, ist sie eine absolute Grenzerfahrung. Wie eine Scheibe nehmen wir das Eiland dann war, kreisrund, auch wenn wir es von der Landkarte besser wissen. Und obwohl wir nicht in permanentem Augenkontakt mit dem Meeressaum sind, fühlen wir doch schmerzlich seine Existenz: Bis hierhin und nicht weiter!, plätschern uns die Wellen ins Ohr, Erkenne deine Grenzen an!, rauscht uns die Brandung zu. Die Wogen der Erkenntnis rollen über uns hinweg, schlagen gegen unsere Schläfen, immer und immer wieder, in ewiger Gleichgültigkeit. Was kümmert sie unsere Sterblichkeit?
Wo Amphibien flexibel reagieren, da verzweifelt der Mensch. Am Ufer wird er zum Choleriker. Er glaubt, seine Suche sei am Ende, er habe dem Unauffindbaren hinterhergejagt, sei einer Utopie aufgesessen, sei dazu verdammt, im falschen Paradies zu verenden. Der Dichter Stefan George beschreibt diese Entzauberung eines Geheimnisses in seinem Gedicht „Der Herr der Insel“, veröffentlicht im Jahr 1894. Der titelgebende Herr ist ein großer Vogel, der seit Urbeginn im Süden auf einer „insel reich an zimmt und öl“ lebt. Sein süßer Gesang lässt die Delfine näher kommen, seine goldenen Federn werfen goldene Funken aufs Meer. Als eines Tages Menschen auf einem Schiff dem Eiland entgegensegeln, um das sagenumwobene Tier zu erblicken, da endet das Gedicht mit folgenden Zeilen: „Verbreitet habe er die grossen schwingen / Verscheidend in gedämpften schmerzeslauten.“
Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 70. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.
Die Journalistin und Kommunikationswissenschaftlerin Brigitte Kramer, geboren 1967 in München, zog es seit ihrem ersten Horizonterlebnis im Kettenkarussell in die Ferne – Paris, Barcelona, New York, Madrid. Heute lebt die Autorin in einem Bergdorf auf Mallorca. Ihren ersten und bislang letzten Inselkoller überwand sie jüngst während eines zweiten Horizonterlebnisses: Auf dem Tafelberg Randa erlangte sie die sichere Erkenntnis, dass Inseln zwischen Himmel und Meer fest verzurrt sind.
| Vita | Die Journalistin und Kommunikationswissenschaftlerin Brigitte Kramer, geboren 1967 in München, zog es seit ihrem ersten Horizonterlebnis im Kettenkarussell in die Ferne – Paris, Barcelona, New York, Madrid. Heute lebt die Autorin in einem Bergdorf auf Mallorca. Ihren ersten und bislang letzten Inselkoller überwand sie jüngst während eines zweiten Horizonterlebnisses: Auf dem Tafelberg Randa erlangte sie die sichere Erkenntnis, dass Inseln zwischen Himmel und Meer fest verzurrt sind. |
|---|---|
| Person | Von Brigitte Kramer |
| Vita | Die Journalistin und Kommunikationswissenschaftlerin Brigitte Kramer, geboren 1967 in München, zog es seit ihrem ersten Horizonterlebnis im Kettenkarussell in die Ferne – Paris, Barcelona, New York, Madrid. Heute lebt die Autorin in einem Bergdorf auf Mallorca. Ihren ersten und bislang letzten Inselkoller überwand sie jüngst während eines zweiten Horizonterlebnisses: Auf dem Tafelberg Randa erlangte sie die sichere Erkenntnis, dass Inseln zwischen Himmel und Meer fest verzurrt sind. |
| Person | Von Brigitte Kramer |