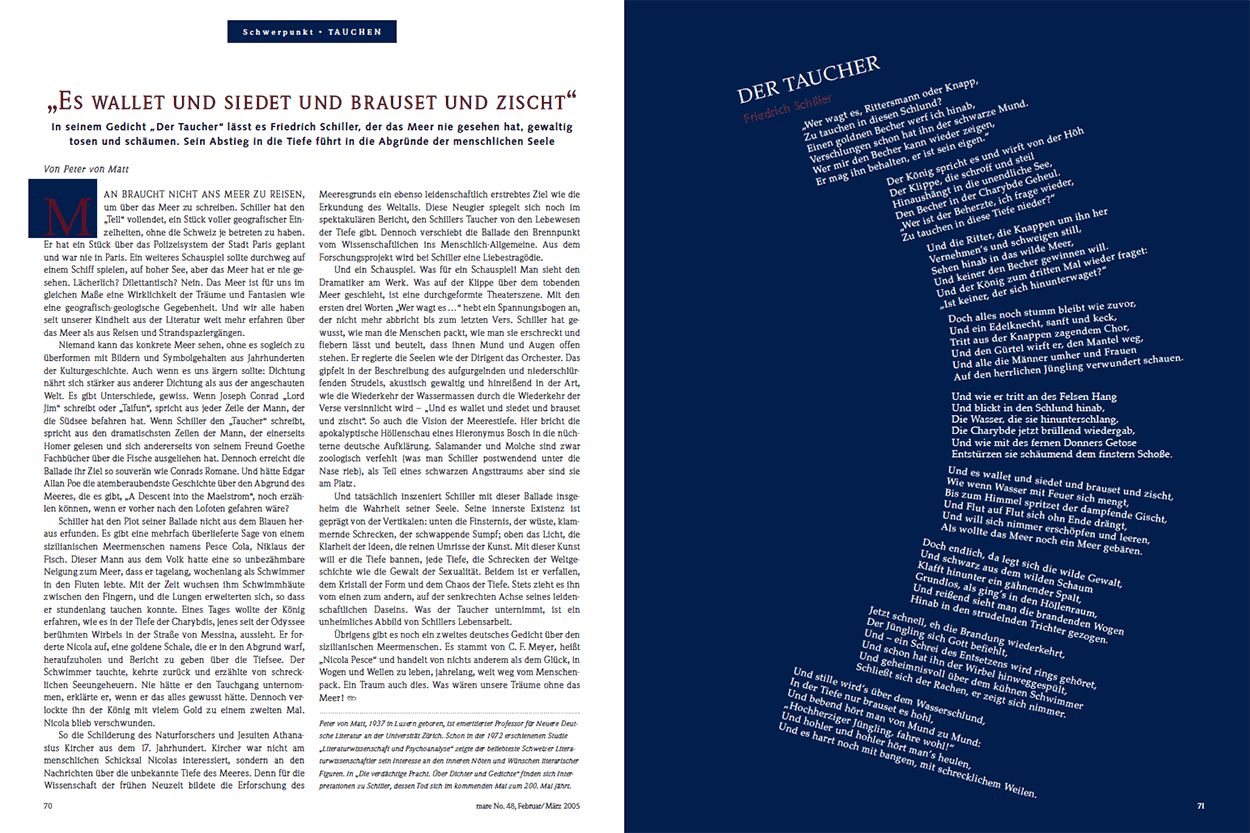„Es wallet und siedet und brauset und zischt“
Man braucht nicht ans Meer zu Reisen, um über das Meer zu schreiben. Schiller hat den „Tell“ vollendet, ein Stück voller geografischer Einzelheiten, ohne die Schweiz je betreten zu haben. Er hat ein Stück über das Polizeisystem der Stadt Paris geplant, und war nie in Paris. Ein weiteres Schauspiel sollte durchweg auf einem Schiff spielen, auf hoher See, aber das Meer hat er nie gesehen. Lächerlich? Dilettantisch? Nein. Das Meer ist für uns im gleichen Maße eine Wirklichkeit der Träume und Fantasien wie eine geografisch-geologische Gegebenheit. Und wir alle haben seit unserer Kindheit aus der Literatur weit mehr erfahren über das Meer als aus Reisen und Strandspaziergängen.
Niemand kann das konkrete Meer sehen, ohne es sogleich zu überformen mit Bildern und Symbolgehalten aus Jahrhunderten der Kulturgeschichte. Auch wenn es uns ärgern sollte: Dichtung nährt sich stärker aus anderer Dichtung als aus der angeschauten Welt. Es gibt Unterschiede, gewiss. Wenn Joseph Conrad „Lord Jim“ schreibt oder „Taifun“, spricht aus jeder Zeile der Mann, der die Südsee befahren hat. Wenn Schiller den „Taucher“ schreibt, spricht aus den dramatischsten Zeilen der Mann, der einerseits Homer gelesen und sich andererseits von seinem Freund Goethe Fachbücher über die Fische ausgeliehen hat. Dennoch erreicht die Ballade ihr Ziel so souverän wie Conrads Romane. Und hätte Edgar Allan Poe die atemberaubendste Geschichte über den Abgrund des Meeres, die es gibt, „A Descent into the Maelstrom“, noch erzählen können, wenn er vorher nach den Lofoten gefahren wäre?
Schiller hat den Plot seiner Ballade nicht aus dem Blauen heraus erfunden. Es gibt eine mehrfach überlieferte Sage von einem sizilianischen Meermenschen namens Pesce Cola, Niklaus der Fisch. Dieser Mann aus dem Volk hatte eine so unbezähmbare Neigung zum Meer, dass er tagelang, wochenlang als Schwimmer in den Fluten lebte. Mit der Zeit wuchsen ihm Schwimmhäute zwischen den Fingern, und die Lungen erweiterten sich, so dass er stundenlang tauchen konnte. Eines Tages wollte der König erfahren, wie es in der Tiefe der Charybdis, jenes seit der Odyssee berühmten Wirbels in der Straße von Messina, aussieht. Er forderte Nicola auf, eine goldene Schale, die er in den Abgrund warf, heraufzuholen und Bericht zu geben über die Tiefsee. Der Schwimmer tauchte, kehrte zurück und erzählte von schrecklichen Seeungeheuern. Nie hätte er den Tauchgang unternommen, erklärte er, wenn er das alles gewusst hätte. Dennoch verlockte ihn der König mit vielem Gold zu einem zweiten Mal. Nicola blieb verschwunden.
So die Schilderung des Naturforschers und Jesuiten Athanasius Kircher aus dem 17. Jahrhundert. Kircher war nicht am menschlichen Schicksal Nicolas interessiert, sondern an den Nachrichten über die unbekannte Tiefe des Meeres. Denn für die Wissenschaft der frühen Neuzeit bildete die Erforschung des Meeresgrunds ein ebenso leidenschaftlich erstrebtes Ziel wie die Erkundung des Weltalls. Diese Neugier spiegelt sich noch im spektakulären Bericht, den Schillers Taucher von den Lebewesen der Tiefe gibt. Dennoch verschiebt die Ballade den Brennpunkt vom Wissenschaftlichen ins Menschlich-Allgemeine. Aus dem Forschungsprojekt wird bei Schiller eine Liebestragödie.
Und ein Schauspiel. Was für ein Schauspiel! Man sieht den Dramatiker am Werk. Was auf der Klippe über dem tobenden Meer geschieht, ist eine durchgeformte Theaterszene. Mit den ersten drei Worten: „Wer wagt es…“ hebt ein Spannungsbogen an, der nicht mehr abbricht bis zum letzten Vers. Schiller hat gewusst, wie man die Menschen packt, wie man sie erschreckt und fiebern lässt und beutelt, dass ihnen Mund und Augen offenstehen. Er regierte die Seelen wie der Dirigent das Orchester. Das gipfelt in der Beschreibung des aufgurgelnden und niederschlürfenden Strudels, akustisch gewaltig und hinreißend in der Art, wie die Wiederkehr der Wassermassen durch die Wiederkehr der Verse versinnlicht wird – „Und es wallet und siedet und brauset und zischt“. So auch die Vision der Meerestiefe. Hier bricht die apokalyptische Höllenschau eines Hieronymus Bosch in die nüchterne deutsche Aufklärung. Salamander und Molche sind zwar zoologisch verfehlt (was man Schiller postwendend unter die Nase rieb), als Teil eines schwarzen Angsttraums aber sind sie am Platz.
Und tatsächlich inszeniert Schiller mit dieser Ballade insgeheim die Wahrheit seiner Seele. Seine innerste Existenz ist geprägt von der Vertikalen: unten die Finsternis, der wüste, klammernde Schrecken, der schwappende Sumpf; oben das Licht, die Klarheit der Ideen, die reinen Umrisse der Kunst. Mit dieser Kunst will er die Tiefe bannen, jede Tiefe, die Schrecken der Weltgeschichte wie die Gewalt der Sexualität. Beidem ist er verfallen, dem Kristall der Form und dem Chaos der Tiefe. Stets zieht es ihn vom einen zum andern, auf der senkrechten Achse seines leidenschaftlichen Daseins. Was der Taucher unternimmt, ist ein unheimliches Abbild von Schillers Lebensarbeit.
Übrigens gibt es noch ein zweites deutsches Gedicht über den sizilianischen Meermenschen. Es stammt von C. F. Meyer, heißt „Nicola Pesce“ und handelt von nichts anderem als dem Glück, in Wogen und Wellen zu leben, jahrelang, weit weg vom Menschenpack. Ein Traum auch dies. Was wären unsere Träume ohne das Meer!
Der Taucher
Friedrich Schiller
„Wer wagt es, Rittersmann oder Knapp,
Zu tauchen in diesen Schlund?
Einen goldnen Becher werf ich hinab,
Verschlungen schon hat ihn der schwarze Mund.
Wer mir den Becher kann wieder zeigen,
Er mag ihn behalten, er ist sein eigen.“
Der König spricht es und wirft von der Höh
Der Klippe, die schroff und steil
Hinaushängt in die unendliche See,
Den Becher in der Charybde Geheul.
„Wer ist der Beherzte, ich frage wieder,
Zu tauchen in diese Tiefe nieder?“
Und die Ritter, die Knappen um ihn her
Vernehmen’s und schweigen still,
Sehen hinab in das wilde Meer,
Und keiner den Becher gewinnen will.
Und der König zum dritten Mal wieder fraget:
„Ist keiner, der sich hinunterwaget?“
Doch alles noch stumm bleibt wie zuvor,
Und ein Edelknecht, sanft und keck,
Tritt aus der Knappen zagendem Chor,
Und den Gürtel wirft er, den Mantel weg,
Und alle die Männer umher und Frauen
Auf den herrlichen Jüngling verwundert schauen.
Und wie er tritt an des Felsen Hang
Und blickt in den Schlund hinab,
Die Wasser, die sie hinunterschlang,
Die Charybde jetzt brüllend wiedergab,
Und wie mit des fernen Donners Getose
Entstürzen sie schäumend dem finstern Schoße.
Und es wallet und siedet und brauset und zischt,
Wie wenn Wasser mit Feuer sich mengt,
Bis zum Himmel spritzet der dampfende Gischt,
Und Flut auf Flut sich ohn Ende drängt,
Und will sich nimmer erschöpfen und leeren,
Als wollte das Meer noch ein Meer gebären.
Doch endlich, da legt sich die wilde Gewalt,
Und schwarz aus dem wilden Schaum
Klafft hinunter ein gähnender Spalt,
Grundlos, als ging’s in den Höllenraum,
Und reißend sieht man die brandenden Wogen
Hinab in den strudelnden Trichter gezogen.
Jetzt schnell, eh die Brandung wiederkehrt,
Der Jüngling sich Gott befiehlt,
Und – ein Schrei des Entsetzens wird rings gehöret,
Und schon hat ihn der Wirbel hinweggespült,
Und geheimnisvoll über dem kühnen Schwimmer
Schließt sich der Rachen, er zeigt sich nimmer.
Und stille wird’s über dem Wasserschlund,
In der Tiefe nur brauset es hohl,
Und bebend hört man von Mund zu Mund:
„Hochherziger Jüngling, fahre wohl!“
Und hohler und hohler hört man’s heulen,
Und es harrt noch mit bangem, mit schrecklichem Weilen.
Peter von Matt, 1937 in Luzern geboren, ist emeritierter Professor für Neuere Deutsche Literatur an der Universität Zürich. Schon in der 1972 erschienenen Studie Literaturwissenschaft und Psychoanalyse zeigte der beliebteste Schweizer Literaturwissenschaftler sein Interesse an den inneren Nöten und Wünschen literarischer Figuren. In Die verdächtige Pracht. Über Dichter und Gedichte finden sich Interpretationen zu Schiller, dessen Tod sich im kommenden Mai zum 250. Mal jährt.
| Vita | Peter von Matt, 1937 in Luzern geboren, ist emeritierter Professor für Neuere Deutsche Literatur an der Universität Zürich. Schon in der 1972 erschienenen Studie Literaturwissenschaft und Psychoanalyse zeigte der beliebteste Schweizer Literaturwissenschaftler sein Interesse an den inneren Nöten und Wünschen literarischer Figuren. In Die verdächtige Pracht. Über Dichter und Gedichte finden sich Interpretationen zu Schiller, dessen Tod sich im kommenden Mai zum 250. Mal jährt. |
|---|---|
| Person | Von Peter von Matt |
| Vita | Peter von Matt, 1937 in Luzern geboren, ist emeritierter Professor für Neuere Deutsche Literatur an der Universität Zürich. Schon in der 1972 erschienenen Studie Literaturwissenschaft und Psychoanalyse zeigte der beliebteste Schweizer Literaturwissenschaftler sein Interesse an den inneren Nöten und Wünschen literarischer Figuren. In Die verdächtige Pracht. Über Dichter und Gedichte finden sich Interpretationen zu Schiller, dessen Tod sich im kommenden Mai zum 250. Mal jährt. |
| Person | Von Peter von Matt |