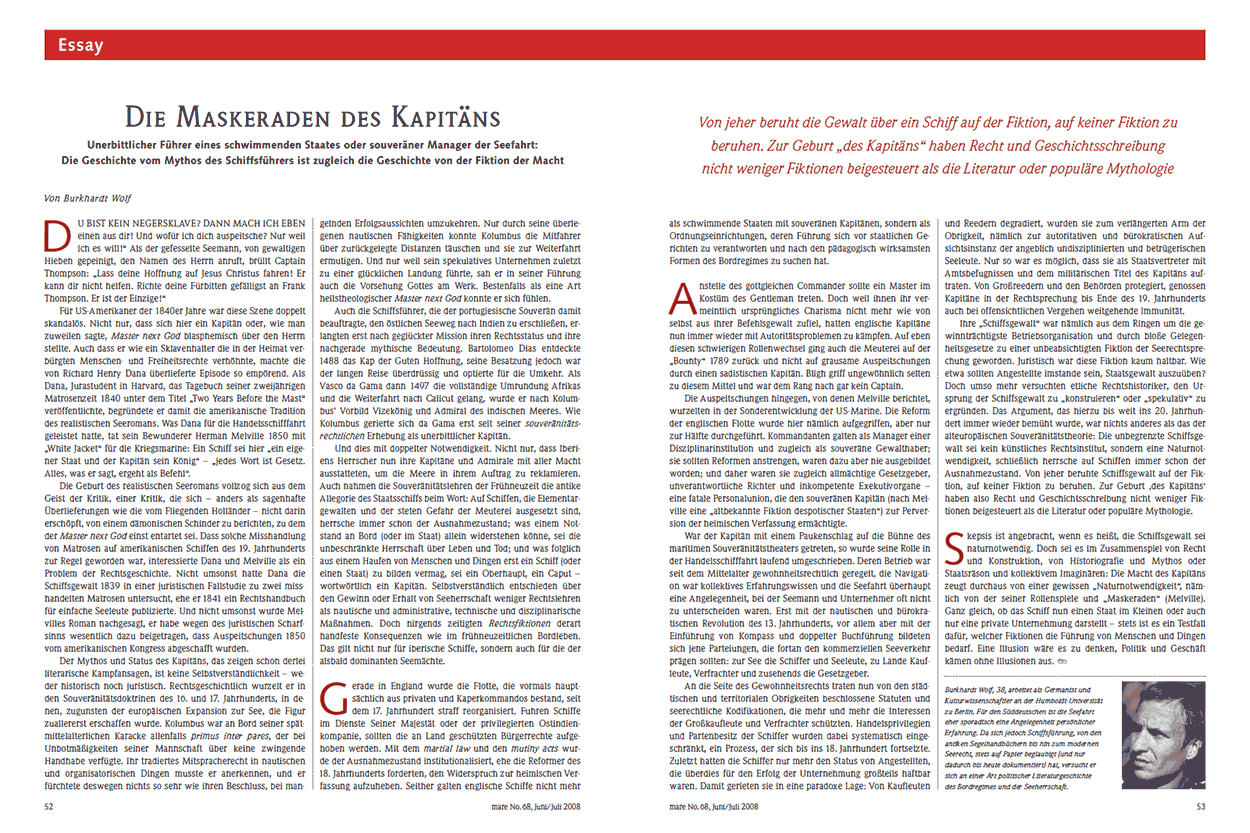Die Maskeraden des Kapitäns
Du bist kein Negersklave? Dann mach ich eben einen aus dir! Und wofür ich dich auspeitsche? Nur weil ich es will!“ Als der gefesselte Seemann, von gewaltigen Hieben gepeinigt, den Namen des Herrn anruft, brüllt Captain Thompson: „Lass deine Hoffnung auf Jesus Christus fahren! Er kann dir nicht helfen. Richte deine Fürbitten gefälligst an Frank Thompson. Er ist der Einzige!“
Für US-Amerikaner der 1840er Jahre war diese Szene doppelt skandalös. Nicht nur, dass sich hier ein Kapitän oder, wie man zuweilen sagte, Master next God blasphemisch über den Herrn stellte. Auch dass er wie ein Sklavenhalter die in der Heimat verbürgten Menschen- und Freiheitsrechte verhöhnte, machte die von Richard Henry Dana überlieferte Episode so empörend. Als Dana, Jurastudent in Harvard, das Tagebuch seiner zweijährigen Matrosenzeit 1840 unter dem Titel „Two Years Before the Mast“ veröffentlichte, begründete er damit die amerikanische Tradition des realistischen Seeromans. Was Dana für die Handelsschifffahrt geleistet hatte, tat sein Bewunderer Herman Melville 1850 mit „White Jacket“ für die Kriegsmarine: Ein Schiff sei hier „ein eigener Staat und der Kapitän sein König“ – „jedes Wort ist Gesetz. Alles, was er sagt, ergeht als Befehl“.
Die Geburt des realistischen Seeromans vollzog sich aus dem Geist der Kritik, einer Kritik, die sich – anders als sagenhafte Überlieferungen wie die vom Fliegenden Holländer – nicht darin erschöpft, von einem dämonischen Schinder zu berichten, zu dem der Master next God einst entartet sei. Dass solche Misshandlung von Matrosen auf amerikanischen Schiffen des 19. Jahrhunderts zur Regel geworden war, interessierte Dana und Melville als ein Problem der Rechtsgeschichte. Nicht umsonst hatte Dana die Schiffsgewalt 1839 in einer juristischen Fallstudie zu zwei misshandelten Matrosen untersucht, ehe er 1841 ein Rechtshandbuch für einfache Seeleute publizierte. Und nicht umsonst wurde Melvilles Roman nachgesagt, er habe wegen des juristischen Scharfsinns wesentlich dazu beigetragen, dass Auspeitschungen 1850 vom amerikanischen Kongress abgeschafft wurden.
Der Mythos und Status des Kapitäns, das zeigen schon derlei literarische Kampfansagen, ist keine Selbstverständlichkeit – weder historisch noch juristisch. Rechtsgeschichtlich wurzelt er in den Souveränitätsdoktrinen des 16. und 17. Jahrhunderts, in denen, zugunsten der europäischen Expansion zur See, die Figur zuallererst erschaffen wurde. Kolumbus war an Bord seiner spätmittelalterlichen Karacke allenfalls primus inter pares, der bei Unbotmäßigkeiten seiner Mannschaft über keine zwingende Handhabe verfügte. Ihr tradiertes Mitspracherecht in nautischen und organisatorischen Dingen musste er anerkennen, und er fürchtete deswegen nichts so sehr wie ihren Beschluss, bei mangelnden Erfolgsaussichten umzukehren. Nur durch seine überlegenen nautischen Fähigkeiten konnte Kolumbus die Mitfahrer über zurückgelegte Distanzen täuschen und sie zur Weiterfahrt ermutigen. Und nur weil sein spekulatives Unternehmen zuletzt zu einer glücklichen Landung führte, sah er in seiner Führung auch die Vorsehung Gottes am Werk. Bestenfalls als eine Art heilstheologischer Master next God konnte er sich fühlen.
Auch die Schiffsführer, die der portugiesische Souverän damit beauftragte, den östlichen Seeweg nach Indien zu erschließen, erlangten erst nach geglückter Mission ihren Rechtsstatus und ihre nachgerade mythische Bedeutung. Bartolomeo Dias entdeckte 1488 das Kap der Guten Hoffnung, seine Besatzung jedoch war der langen Reise überdrüssig und optierte für die Umkehr. Als Vasco da Gama dann 1497 die vollständige Umrundung Afrikas und die Weiterfahrt nach Calicut gelang, wurde er nach Kolumbus’ Vorbild Vizekönig und Admiral des indischen Meeres. Wie Kolumbus gerierte sich da Gama erst seit seiner souveränitätsrechtlichen Erhebung als unerbittlicher Kapitän.
Und dies mit doppelter Notwendigkeit. Nicht nur, dass Iberiens Herrscher nun ihre Kapitäne und Admirale mit aller Macht ausstatteten, um die Meere in ihrem Auftrag zu reklamieren. Auch nahmen die Souveränitätslehren der Frühneuzeit die antike Allegorie des Staatsschiffs beim Wort: Auf Schiffen, die Elementargewalten und der steten Gefahr der Meuterei ausgesetzt sind, herrsche immer schon der Ausnahmezustand; was einem Notstand an Bord (oder im Staat) allein widerstehen könne, sei die unbeschränkte Herrschaft über Leben und Tod; und was folglich aus einem Haufen von Menschen und Dingen erst ein Schiff (oder einen Staat) zu bilden vermag, sei ein Oberhaupt, ein Caput – wortwörtlich ein Kapitän. Selbstverständlich entschieden über den Gewinn oder Erhalt von Seeherrschaft weniger Rechtslehren als nautische und administrative, technische und disziplinarische Maßnahmen. Doch nirgends zeitigten Rechtsfiktionen derart handfeste Konsequenzen wie im frühneuzeitlichen Bordleben. Das gilt nicht nur für iberische Schiffe, sondern auch für die der alsbald dominanten Seemächte.
Gerade in England wurde die Flotte, die vormals hauptsächlich aus privaten und Kaperkommandos bestand, seit dem 17. Jahrhundert straff reorganisiert. Fuhren Schiffe im Dienste Seiner Majestät oder der privilegierten Ostindienkompanie, sollten die an Land geschützten Bürgerrechte aufgehoben werden. Mit dem martial law und den mutiny acts wurde der Ausnahmezustand institutionalisiert, ehe die Reformer des 18. Jahrhunderts forderten, den Widerspruch zur heimischen Verfassung aufzuheben. Seither galten englische Schiffe nicht mehr als schwimmende Staaten mit souveränen Kapitänen, sondern als Ordnungseinrichtungen, deren Führung sich vor staatlichen Gerichten zu verantworten und nach den pädagogisch wirksamsten Formen des Bordregimes zu suchen hat.
Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 68. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.
Burkhardt Wolf arbeitet als Germanist und Kulturwissenschaftler an der Humboldt-Universität zu Berlin. Für den Süddeutschen ist die Seefahrt eher sporadisch eine Angelegenheit persönlicher Erfahrung. Da sich jedoch Schiffsführung, von den antiken Segelhandbüchern bis hin zum modernen Seerecht, stets auf Papier beglaubigt (und nur dadurch bis heute dokumentiert) hat, versucht er sich an einer Art politischer Literaturgeschichte des Bordregimes und der Seeherrschaft.
| Vita | Burkhardt Wolf arbeitet als Germanist und Kulturwissenschaftler an der Humboldt-Universität zu Berlin. Für den Süddeutschen ist die Seefahrt eher sporadisch eine Angelegenheit persönlicher Erfahrung. Da sich jedoch Schiffsführung, von den antiken Segelhandbüchern bis hin zum modernen Seerecht, stets auf Papier beglaubigt (und nur dadurch bis heute dokumentiert) hat, versucht er sich an einer Art politischer Literaturgeschichte des Bordregimes und der Seeherrschaft. |
|---|---|
| Person | Von Burkhardt Wolf |
| Vita | Burkhardt Wolf arbeitet als Germanist und Kulturwissenschaftler an der Humboldt-Universität zu Berlin. Für den Süddeutschen ist die Seefahrt eher sporadisch eine Angelegenheit persönlicher Erfahrung. Da sich jedoch Schiffsführung, von den antiken Segelhandbüchern bis hin zum modernen Seerecht, stets auf Papier beglaubigt (und nur dadurch bis heute dokumentiert) hat, versucht er sich an einer Art politischer Literaturgeschichte des Bordregimes und der Seeherrschaft. |
| Person | Von Burkhardt Wolf |