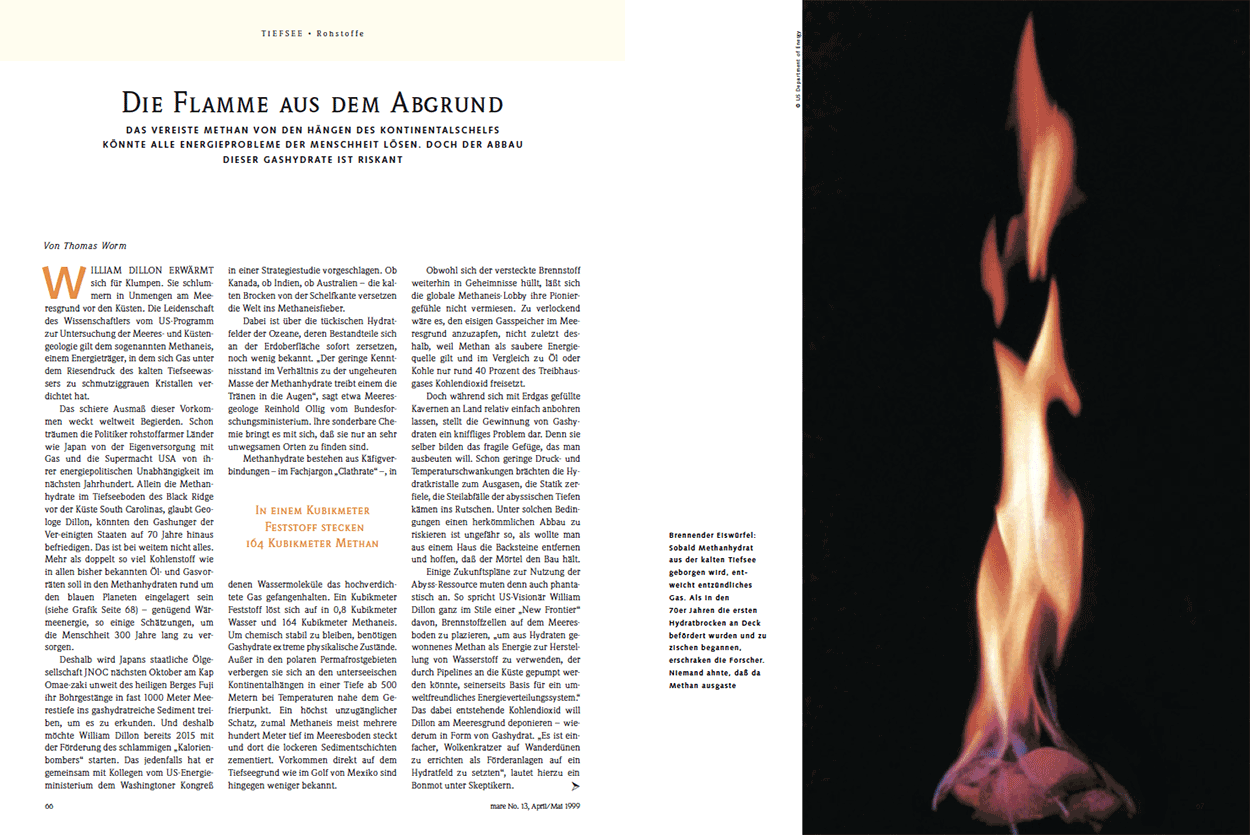Die Flamme aus dem Abgrund
William Dillon erwärmt sich für Klumpen. Sie schlummern in Unmengen am Meeresgrund vor den Küsten. Die Leidenschaft des Wissenschaftlers vom US-Programm zur Untersuchung der Meeres- und Küstengeologie gilt dem sogenannten Methaneis, einem Energieträger, in dem sich Gas unter dem Riesendruck des kalten Tiefseewassers zu schmutziggrauen Kristallen verdichtet hat.
Das schiere Ausmaß dieser Vorkommen weckt weltweit Begierden. Schon träumen die Politiker rohstoffarmer Länder wie Japan von der Eigenversorgung mit Gas und die Supermacht USA von ihrer energiepolitischen Unabhängigkeit im nächsten Jahrhundert. Allein die Methanhydrate im Tiefseeboden des Black Ridge vor der Küste South Carolinas, glaubt Geologe Dillon, könnten den Gashunger der Vereinigten Staaten auf 70 Jahre hinaus befriedigen. Das ist bei weitem nicht alles. Mehr als doppelt so viel Kohlenstoff wie in allen bisher bekannten Öl- und Gasvorräten soll in den Methanhydraten rund um den blauen Planeten eingelagert sein (siehe Grafik Seite 68) – genügend Wärmeenergie, so einige Schätzungen, um die Menschheit 300 Jahre lang zu versorgen.
Deshalb wird Japans staatliche Ölgesellschaft JNOC nächsten Oktober am Kap Omaezaki unweit des heiligen Berges Fuji ihr Bohrgestänge in fast 1000 Meter Meerestiefe ins gashydratreiche Sediment treiben, um es zu erkunden. Und deshalb möchte William Dillon bereits 2015 mit der Förderung des schlammigen „Kalorienbombers“ starten. Das jedenfalls hat er gemeinsam mit Kollegen vom US-Energieministerium dem Washingtoner Kongreß in einer Strategiestudie vorgeschlagen. Ob Kanada, ob Indien, ob Australien – die kalten Brocken von der Schelfkante versetzen die Welt ins Methaneisfieber.
Dabei ist über die tückischen Hydratfelder der Ozeane, deren Bestandteile sich an der Erdoberfläche sofort zersetzen, noch wenig bekannt. „Der geringe Kenntnisstand im Verhältnis zu der ungeheuren Masse der Methanhydrate treibt einem die Tränen in die Augen“, sagt etwa Meeresgeologe Reinhold Ollig vom Bundesforschungsministerium. Ihre sonderbare Chemie bringt es mit sich, daß sie nur an sehr unwegsamen Orten zu finden sind.
Methanhydrate bestehen aus Käfigverbindungen – im Fachjargon „Clathrate“ –, in denen Wassermoleküle das hochverdichtete Gas gefangenhalten. Ein Kubikmeter Feststoff löst sich auf in 0,8 Kubikmeter Wasser und 164 Kubikmeter Methaneis. Um chemisch stabil zu bleiben, benötigen Gashydrate extreme physikalische Zustände. Außer in den polaren Permafrostgebieten verbergen sie sich an den unterseeischen Kontinentalhängen in einer Tiefe ab 500 Metern bei Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt. Ein höchst unzugänglicher Schatz, zumal Methaneis meist mehrere hundert Meter tief im Meeresboden steckt und dort die lockeren Sedimentschichten zementiert. Vorkommen direkt auf dem Tiefseegrund wie im Golf von Mexiko sind hingegen weniger bekannt.
Obwohl sich der versteckte Brennstoff weiterhin in Geheimnisse hüllt, läßt sich die globale Methaneis-Lobby ihre Pioniergefühle nicht vermiesen. Zu verlockend wäre es, den eisigen Gasspeicher im Meeresgrund anzuzapfen, nicht zuletzt deshalb, weil Methan als saubere Energiequelle gilt und im Vergleich zu Öl oder Kohle nur rund 40 Prozent des Treibhausgases Kohlendioxid freisetzt.
Doch während sich mit Erdgas gefüllte Kavernen an Land relativ einfach anbohren lassen, stellt die Gewinnung von Gashydraten ein kniffliges Problem dar. Denn sie selber bilden das fragile Gefüge, das man ausbeuten will. Schon geringe Druck- und Temperaturschwankungen brächten die Hydratkristalle zum Ausgasen, die Statik zerfiele, die Steilabfälle der abyssischen Tiefen kämen ins Rutschen. Unter solchen Bedingungen einen herkömmlichen Abbau zu riskieren ist ungefähr so, als wollte man aus einem Haus die Backsteine entfernen und hoffen, daß der Mörtel den Bau hält.
Einige Zukunftspläne zur Nutzung der Abyss-Ressource muten denn auch phantastisch an. So spricht US-Visionär William Dillon ganz im Stile einer „New Frontier“ davon, Brennstoffzellen auf dem Meeresboden zu plazieren, „um aus Hydraten gewonnenes Methan als Energie zur Herstellung von Wasserstoff zu verwenden, der durch Pipelines an die Küste gepumpt werden könnte, seinerseits Basis für ein umweltfreundliches Energieverteilungssystem.“ Das dabei entstehende Kohlendioxid will Dillon am Meeresgrund deponieren – wiederum in Form von Gashydrat. „Es ist einfacher, Wolkenkratzer auf Wanderdünen zu errichten als Förderanlagen auf ein Hydratfeld zu setzen“, lautet hierzu ein Bonmot unter Skeptikern.
Weniger abenteuerlich klingt da schon die „Strohhalmtechnik“, bei der das Gas durch gezielte Wärmezufuhr aus den Hydraten gelöst wird, um es dann in Röhren nach oben zu befördern. „Bisher existiert so eine Technik ausschließlich auf dem Papier“, dämpft Hans Amman übertriebene Erwartungen. Der Leiter der Versuchsanstalt für Schiffs- und Wasserbau in Berlin entwickelt derzeit mit EU-Zuschüssen spezielles Bohrgerät, das Gashydrat-Proben unverändert an die Wasseroberfläche holt. Und bereits das ist kompliziert genug.
Obwohl Abbautechnologien noch reine Utopien sind, investieren die Industrieländer – vor allem jene mit Vorkommen innerhalb ihrer 200-Meilen-Zone – in die Exploration. Auch Deutschland legt ein Millionen-Programm auf. „Zur Erforschung der Gashydrate wird weltweit mindestens eine Viertelmilliarde Mark ausgegeben“, schätzt Methaneis-Experte Gerhard Bohrmann vom Kieler Geomar-Institut. Allen voran die Regierung in Tokio, die für 80 Millionen Dollar die Clathratfelder vor der Küste Nippons begutachten läßt.
Der Eifer der Japaner erstaunt. Sind nicht einmal Fördertechnologien in Sicht, dann ist es auch um die Wirtschaftlichkeit schlecht bestellt. „Die Methanhydratforschung zahlt sich nicht unmittelbar aus“, lautet das nüchterne Fazit der Strategiestudie des US-Energieministeriums. Wann aber wäre eine Förderung frühestens kommerziell sinnvoll? Sämtliche Rentabilitäts-Überlegungen verweisen auf eine ferne Zukunft. „Der jetztige Gaspreis müßte fünf- bis zehnmal so hoch sein“, prognostiziert Wirtschaftsingenieur Hans Amman, „und bis es soweit ist, vergehen 30 bis 50 Jahre, legt man den heutigen Brennstoffvorrat zugrunde.“
Hier allerdings kommen die Japaner wieder ins Spiel. Das ressourcenarme Inselreich ist darauf angewiesen, teures Flüssiggas in Tankschiffen zu importieren; eine Unterwasserpipeline existiert nicht. Dadurch ist der Gaspreis in Japan heute drei- bis fünfmal höher als anderswo – und mithin die Wirtschaftlichkeitsschwelle zur Nutzung von „Tiefseegas“ wesentlich niedriger. Viel früher als in anderen Ländern könnte die Ausbeutung von Clathratfeldern in Japan zum einträglichen Geschäft avancieren.
Doch vor der blauen Flamme aus dem Meeresabgrund steht der Tsunami. Schon vor ungefähr 7000 Jahren gerieten bei der Storegga-Rutschung an Norwegens Küste 5000 Kubikkilometer Sedimentboden spontan in Bewegung, sehr wahrscheinlich durch zerfallende Gashydrate. Diese Masse würde das Saarland zwei Kilometer hoch bedecken. Eine unvorstellbare Unterwasserlawine rauschte die Schelfhänge hinab. Die Spuren der ausgelösten Flutwelle sind heute noch in Schottland zu besichtigen – Meeressandmassen, kilometerweit ins Inland gespült. Zudem vermuten Wissenschaftler, daß der Tsunami vom vergangenen Jahr, der in Papua-Neuguinea eine Ortschaft mit mehreren tausend Bewohnern auslöschte, auf eine durch Seebeben verursachte Gashydrat-Rutschung zurückgeht.
Ebenso gigantisch wie die Methaneisvorkommen scheinen also gegenwärtig die Umweltrisiken, sollten Hydrate aus den Kontinentalflanken industriell abgebaut werden. Denn jedwede Förderungstechnik ist mit Erschütterungen der sensiblen Ressource verbunden, mit Temperatur- und Druckveränderungen. Gerhard Bohrmann vom Geomar-Institut hält „30 Meter hohe Flutwogen, durch Schlammlawinen à la Storegga verursacht, durchaus für realistisch.“ Eine solche Welle, träfe sie Japans südliche Buchten, würde Tokio binnen Augenblicken in einen leergeschwemmten Archipel aus Büroturminseln verwandeln. Und nicht nur das Zentrum des Ballungsraums mit seinen 25 Millionen Menschen wäre in Mitleidenschaft gezogen. Das japanische Wort Tsunami – „Welle im Hafen“ – erhielte eine neue Dimension.
Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 13. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.
Thomas Worm, Jahrgang 1957, ist mare-Redakteur für Wirtschaft und Politik. In No.12 beschrieb er die Geschichte des Containers (zusammen mit Claudia Karstedt)
| Vita | Thomas Worm, Jahrgang 1957, ist mare-Redakteur für Wirtschaft und Politik. In No.12 beschrieb er die Geschichte des Containers (zusammen mit Claudia Karstedt) |
|---|---|
| Person | Von Thomas Worm |
| Vita | Thomas Worm, Jahrgang 1957, ist mare-Redakteur für Wirtschaft und Politik. In No.12 beschrieb er die Geschichte des Containers (zusammen mit Claudia Karstedt) |
| Person | Von Thomas Worm |