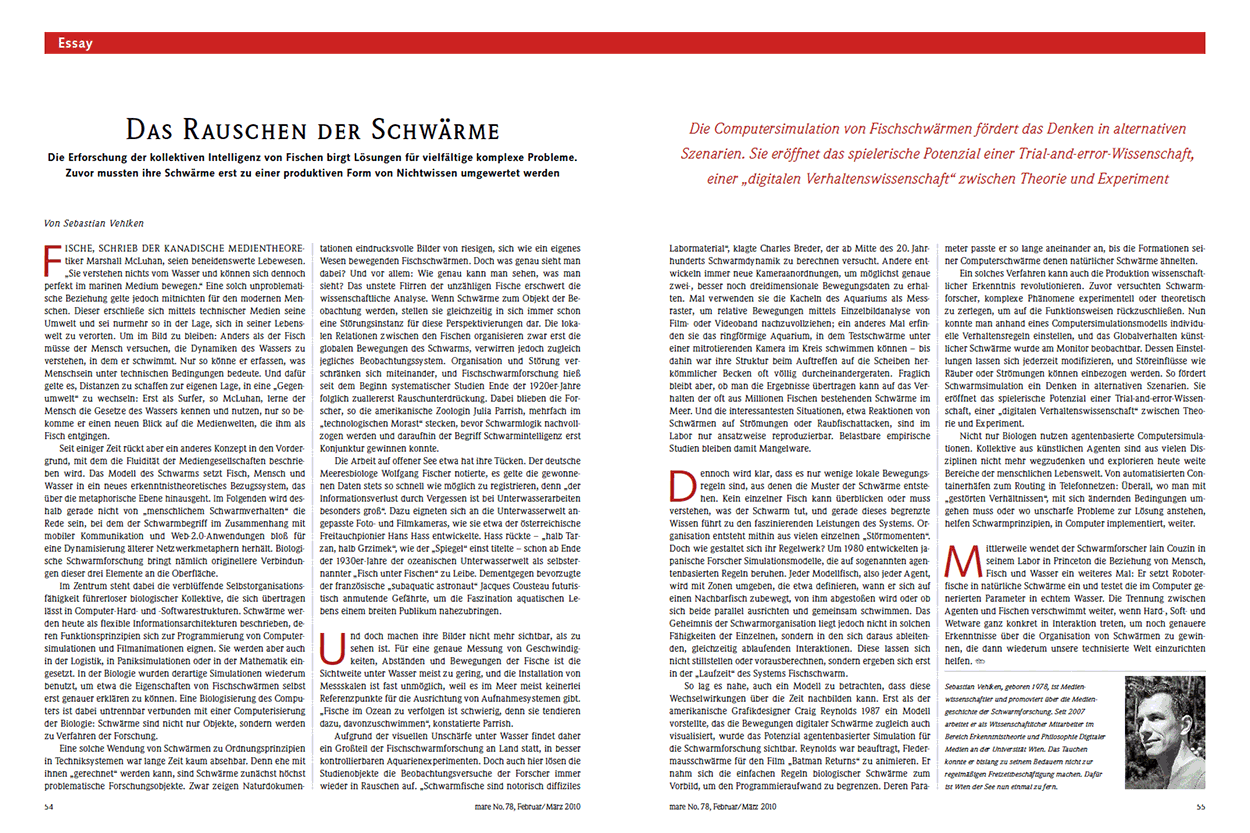Das Rauschen der Schwärme
Fische“, schrieb der kanadische Medientheoretiker Marshall McLuhan, „sind beneidenswerte Lebewesen. Sie verstehen nichts vom Wasser und können sich dennoch perfekt im marinen Medium bewegen.“ Eine solch unproblematische Beziehung gelte jedoch mitnichten für den modernen Menschen. Dieser erschließe sich mittels technischer Medien seine Umwelt und sei nurmehr so in der Lage, sich in seiner Lebenswelt zu verorten. Um im Bild zu bleiben: Anders als der Fisch müsse der Mensch versuchen, die Dynamiken des Wassers zu verstehen, in dem er schwimmt. Nur so könne er erfassen, was Menschsein unter technischen Bedingungen bedeute. Und dafür gelte es, Distanzen zu schaffen zur eigenen Lage, in eine „Gegenumwelt“ zu wechseln: Erst als Surfer, so McLuhan, lerne der Mensch die Gesetze des Wassers kennen und nutzen, nur so bekomme er einen neuen Blick auf die Medienwelten, die ihm als Fisch entgingen.
Seit einiger Zeit rückt aber ein anderes Konzept in den Vordergrund, mit dem die Fluidität der Mediengesellschaften beschrieben wird. Das Modell des Schwarms setzt Fisch, Mensch und Wasser in ein neues erkenntnistheoretisches Bezugssystem, das über die metaphorische Ebene hinausgeht. Im Folgenden wird deshalb gerade nicht von „menschlichem Schwarmverhalten“ die Rede sein, bei dem der Schwarmbegriff im Zusammenhang mit mobiler Kommunikation und Web-2.0-Anwendungen bloß für eine Dynamisierung älterer Netzwerkmetaphern herhält. Biologische Schwarmforschung bringt nämlich originellere Verbindungen dieser drei Elemente an die Oberfläche.
Im Zentrum steht dabei die verblüffende Selbstorganisationsfähigkeit führerloser biologischer Kollektive, die sich übertragen lässt in Computer-Hard- und -Softwarestrukturen. Schwärme werden heute als flexible Informationsarchitekturen beschrieben, deren Funktionsprinzipien sich zur Programmierung von Computersimulationen und Filmanimationen eignen. Sie werden aber auch in der Logistik, in Paniksimulationen oder in der Mathematik eingesetzt. In der Biologie wurden derartige Simulationen wiederum benutzt, um etwa die Eigenschaften von Fischschwärmen selbst erst genauer erklären zu können. Eine Biologisierung des Computers ist dabei untrennbar verbunden mit einer Computerisierung der Biologie: Schwärme sind nicht nur Objekte, sondern werden zu Verfahren der Forschung.
Eine solche Wendung von Schwärmen zu Ordnungsprinzipien in Techniksystemen war lange Zeit kaum absehbar. Denn ehe mit ihnen „gerechnet“ werden kann, sind Schwärme zunächst höchst problematische Forschungsobjekte. Zwar zeigen Naturdokumentationen eindrucksvolle Bilder von riesigen, sich wie ein eigenes Wesen bewegenden Fischschwärmen. Doch was genau sieht man dabei? Und vor allem: Wie genau kann man sehen, was man sieht? Das unstete Flirren der unzähligen Fische erschwert die wissenschaftliche Analyse. Wenn Schwärme zum Objekt der Beobachtung werden, stellen sie gleichzeitig in sich immer schon eine Störungsinstanz für diese Perspektivierungen dar. Die lokalen Relationen zwischen den Fischen organisieren zwar erst die globalen Bewegungen des Schwarms, verwirren jedoch zugleich jegliches Beobachtungssystem. Organisation und Störung verschränken sich miteinander, und Fischschwarmforschung hieß seit dem Beginn systematischer Studien Ende der 1920er Jahre folglich zuallererst Rauschunterdrückung. Dabei blieben die Forscher, so die amerikanische Zoologin Julia Parrish, mehrfach im „technologischen Morast“ stecken, bevor Schwarmlogik nachvollzogen werden und daraufhin der Begriff Schwarmintelligenz erst Konjunktur gewinnen konnte.
Die Arbeit auf offener See etwa hat ihre Tücken. Der deutsche Meeresbiologe Wolfgang Fischer notierte, es gelte die gewonnenen Daten stets so schnell wie möglich zu registrieren, denn „der Informationsverlust durch Vergessen ist bei Unterwasserarbeiten besonders groß“. Dazu eigneten sich an die Unterwasserwelt angepasste Foto- und Filmkameras, wie sie etwa der österreichische Freitauchpionier Hans Hass entwickelte. Hass rückte – „halb Tarzan, halb Grzimek“, wie der „Spiegel“ einst titelte – schon ab Ende der 1930er Jahre der ozeanischen Unterwasserwelt als selbsternannter „Fisch unter Fischen“ zu Leibe. Dementgegen bevorzugte der französische „subaquatic astronaut“ Jacques Cousteau futuristisch anmutende Gefährte, um die Faszination aquatischen Lebens einem breiten Publikum nahezubringen.
Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 78. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.
Sebastian Vehlken, geboren 1978, ist Medienwissenschaftler und promoviert über die Mediengeschichte der Schwarmforschung. Seit 2007 arbeitet er als Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Erkenntnistheorie und Philosophie Digitaler Medien an der Universität Wien. Das Tauchen konnte er bislang zu seinem Bedauern nicht zur regelmäßigen Freizeitbeschäftigung machen. Dafür ist Wien der See nun einmal zu fern.
| Vita | Sebastian Vehlken, geboren 1978, ist Medienwissenschaftler und promoviert über die Mediengeschichte der Schwarmforschung. Seit 2007 arbeitet er als Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Erkenntnistheorie und Philosophie Digitaler Medien an der Universität Wien. Das Tauchen konnte er bislang zu seinem Bedauern nicht zur regelmäßigen Freizeitbeschäftigung machen. Dafür ist Wien der See nun einmal zu fern. |
|---|---|
| Person | Von Sebastian Vehlken |
| Vita | Sebastian Vehlken, geboren 1978, ist Medienwissenschaftler und promoviert über die Mediengeschichte der Schwarmforschung. Seit 2007 arbeitet er als Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Erkenntnistheorie und Philosophie Digitaler Medien an der Universität Wien. Das Tauchen konnte er bislang zu seinem Bedauern nicht zur regelmäßigen Freizeitbeschäftigung machen. Dafür ist Wien der See nun einmal zu fern. |
| Person | Von Sebastian Vehlken |