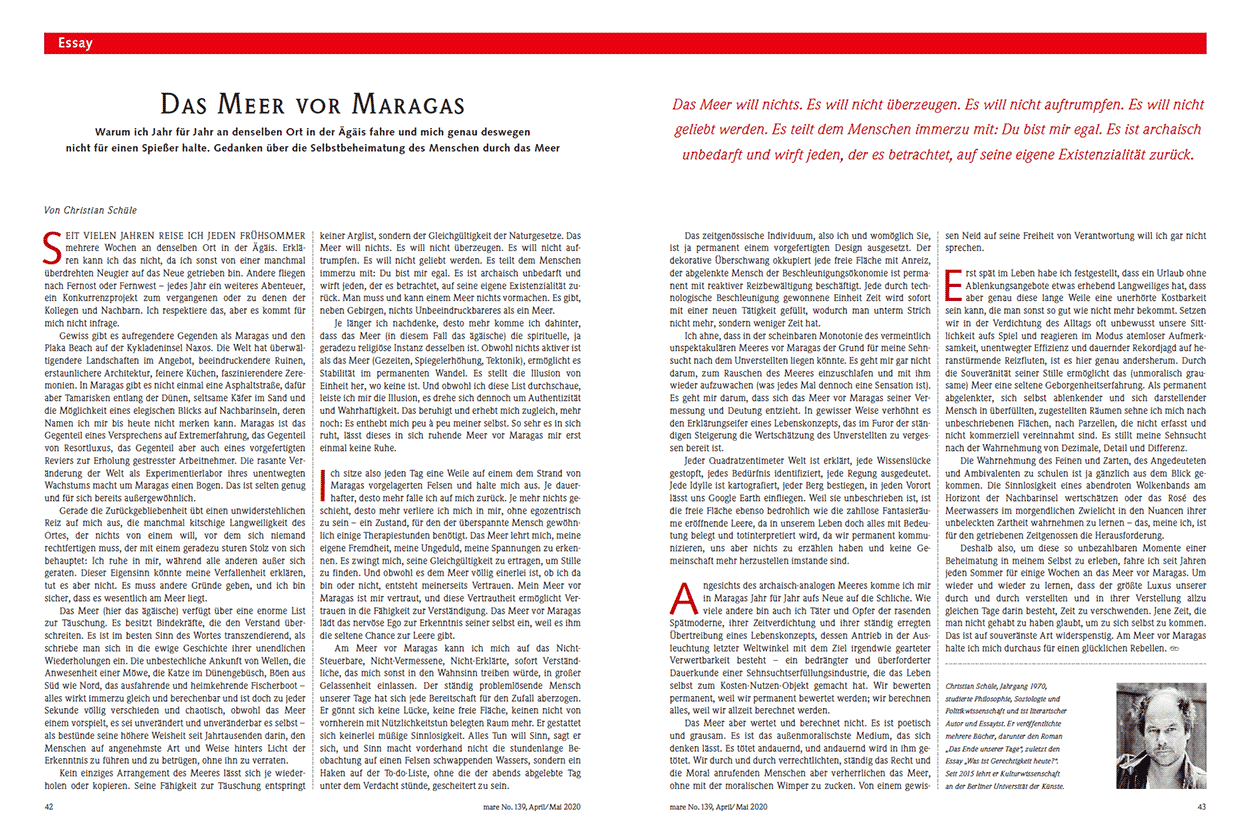Das Meer vor Maragas
Seit vielen Jahren reise ich jeden Frühsommer mehrere Wochen an denselben Ort in der Ägäis. Erklären kann ich das nicht, da ich sonst von einer manchmal überdrehten Neugier auf das Neue getrieben bin. Andere fliegen nach Fernost oder Fernwest – jedes Jahr ein weiteres Abenteuer, ein Konkurrenzprojekt zum vergangenen oder zu denen der Kollegen und Nachbarn. Ich respektiere das, aber es kommt für mich nicht infrage.
Gewiss gibt es aufregendere Gegenden als Maragas und den Plaka Beach auf der Kykladeninsel Naxos. Die Welt hat überwältigendere Landschaften im Angebot, beeindruckendere Ruinen, erstaunlichere Architektur, feinere Küchen, faszinierendere Zeremonien. In Maragas gibt es nicht einmal eine Asphaltstraße, dafür aber Tamarisken entlang der Dünen, seltsame Käfer im Sand und die Möglichkeit eines elegischen Blicks auf Nachbarinseln, deren Namen ich mir bis heute nicht merken kann. Maragas ist das Gegenteil eines Versprechens auf Extremerfahrung, das Gegenteil von Resortluxus, das Gegenteil aber auch eines vorgefertigten Reviers zur Erholung gestresster Arbeitnehmer. Die rasante Veränderung der Welt als Experimentierlabor ihres unentwegten Wachstums macht um Maragas einen Bogen. Das ist selten genug und für sich bereits außergewöhnlich.
Gerade die Zurückgebliebenheit übt einen unwiderstehlichen Reiz auf mich aus, die manchmal kitschige Langweiligkeit des Ortes, der nichts von einem will, vor dem sich niemand rechtfertigen muss, der mit einem geradezu sturen Stolz von sich behauptet: Ich ruhe in mir, während alle anderen außer sich geraten. Dieser Eigensinn könnte meine Verfallenheit erklären, tut es aber nicht. Es muss andere Gründe geben, und ich bin sicher, dass es wesentlich am Meer liegt.
Das Meer (hier das ägäische) verfügt über eine enorme List zur Täuschung. Es besitzt Bindekräfte, die den Verstand überschreiten. Es ist im besten Sinn des Wortes transzendierend, als schriebe man sich in die ewige Geschichte ihrer unendlichen Wiederholungen ein. Die unbestechliche Ankunft von Wellen, die Anwesenheit einer Möwe, die Katze im Dünengebüsch, Böen aus Süd wie Nord, das ausfahrende und heimkehrende Fischerboot – alles wirkt immerzu gleich und berechenbar und ist doch zu jeder Sekunde völlig verschieden und chaotisch, obwohl das Meer einem vorspielt, es sei unverändert und unveränderbar es selbst – als bestünde seine höhere Weisheit seit Jahrtausenden darin, den Menschen auf angenehmste Art und Weise hinters Licht der Erkenntnis zu führen und zu betrügen, ohne ihn zu verraten.
Kein einziges Arrangement des Meeres lässt sich je wiederholen oder kopieren. Seine Fähigkeit zur Täuschung entspringt keiner Arglist, sondern der Gleichgültigkeit der Naturgesetze. Das Meer will nichts. Es will nicht überzeugen. Es will nicht auftrumpfen. Es will nicht geliebt werden. Es teilt dem Menschen immerzu mit: Du bist mir egal. Es ist archaisch unbedarft und wirft jeden, der es betrachtet, auf seine eigene Existenzialität zurück. Man muss und kann einem Meer nichts vormachen. Es gibt, neben Gebirgen, nichts Unbeeindruckbareres als ein Meer.
Je länger ich nachdenke, desto mehr komme ich dahinter, dass das Meer (in diesem Fall das ägäische) die spirituelle, ja geradezu religiöse Instanz desselben ist. Obwohl nichts aktiver ist als das Meer (Gezeiten, Spiegelerhöhung, Tektonik), ermöglicht es Stabilität im permanenten Wandel. Es stellt die Illusion von Einheit her, wo keine ist. Und obwohl ich diese List durchschaue, leiste ich mir die Illusion, es drehe sich dennoch um Authentizität und Wahrhaftigkeit. Das beruhigt und erhebt mich zugleich, mehr noch: Es enthebt mich peu à peu meiner selbst. So sehr es in sich ruht, lässt dieses in sich ruhende Meer vor Maragas mir erst einmal keine Ruhe.
Ich sitze also jeden Tag eine Weile auf einem dem Strand von Maragas vorgelagerten Felsen und halte mich aus. Je dauerhafter, desto mehr falle ich auf mich zurück. Je mehr nichts geschieht, desto mehr verliere ich mich in mir, ohne egozentrisch zu sein – ein Zustand, für den der überspannte Mensch gewöhnlich einige Therapiestunden benötigt. Das Meer lehrt mich, meine eigene Fremdheit, meine Ungeduld, meine Spannungen zu erkennen. Es zwingt mich, seine Gleichgültigkeit zu ertragen, um Stille zu finden. Und obwohl es dem Meer völlig einerlei ist, ob ich da bin oder nicht, entsteht meinerseits Vertrauen. Mein Meer vor Maragas ist mir vertraut, und diese Vertrautheit ermöglicht Vertrauen in die Fähigkeit zur Verständigung. Das Meer vor Maragas lädt das nervöse Ego zur Erkenntnis seiner selbst ein, weil es ihm die seltene Chance zur Leere gibt.
Am Meer vor Maragas kann ich mich auf das Nicht-Steuerbare, Nicht-Vermessene, Nicht-Erklärte, sofort Verständliche, das mich sonst in den Wahnsinn treiben würde, in großer Gelassenheit einlassen. Der ständig problemlösende Mensch unserer Tage hat sich jede Bereitschaft für den Zufall aberzogen. Er gönnt sich keine Lücke, keine freie Fläche, keinen nicht von vornherein mit Nützlichkeitstun belegten Raum mehr. Er gestattet sich keinerlei müßige Sinnlosigkeit. Alles Tun will Sinn, sagt er sich, und Sinn macht vorderhand nicht die stundenlange Beobachtung auf einen Felsen schwappenden Wassers, sondern ein Haken auf der To-do-Liste, ohne die der abends abgelebte Tag unter dem Verdacht stünde, gescheitert zu sein.
Das zeitgenössische Individuum, also ich und womöglich Sie, ist ja permanent einem vorgefertigten Design ausgesetzt. Der dekorative Überschwang okkupiert jede freie Fläche mit Anreiz, der abgelenkte Mensch der Beschleunigungsökonomie ist permanent mit reaktiver Reizbewältigung beschäftigt. Jede durch technologische Beschleunigung gewonnene Einheit Zeit wird sofort mit einer neuen Tätigkeit gefüllt, wodurch man unterm Strich nicht mehr, sondern weniger Zeit hat.
Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 139. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.
Christian Schüle, Jahrgang 1970, studierte Philosophie, Soziologie und Politikwissenschaft und ist literarischer Autor und Essayist. Er veröffentlichte mehrere Bücher, darunter den Roman Das Ende unserer Tage, zuletzt die Essays „Heimat“ und „In der Kampfzone“. Seit 2015 lehrt er Kulturwissenschaft an der Universität der Künste in Berlin.
| Vita | Christian Schüle, Jahrgang 1970, studierte Philosophie, Soziologie und Politikwissenschaft und ist literarischer Autor und Essayist. Er veröffentlichte mehrere Bücher, darunter den Roman Das Ende unserer Tage, zuletzt die Essays „Heimat“ und „In der Kampfzone“. Seit 2015 lehrt er Kulturwissenschaft an der Universität der Künste in Berlin. |
|---|---|
| Person | Von Christian Schüle |
| Vita | Christian Schüle, Jahrgang 1970, studierte Philosophie, Soziologie und Politikwissenschaft und ist literarischer Autor und Essayist. Er veröffentlichte mehrere Bücher, darunter den Roman Das Ende unserer Tage, zuletzt die Essays „Heimat“ und „In der Kampfzone“. Seit 2015 lehrt er Kulturwissenschaft an der Universität der Künste in Berlin. |
| Person | Von Christian Schüle |