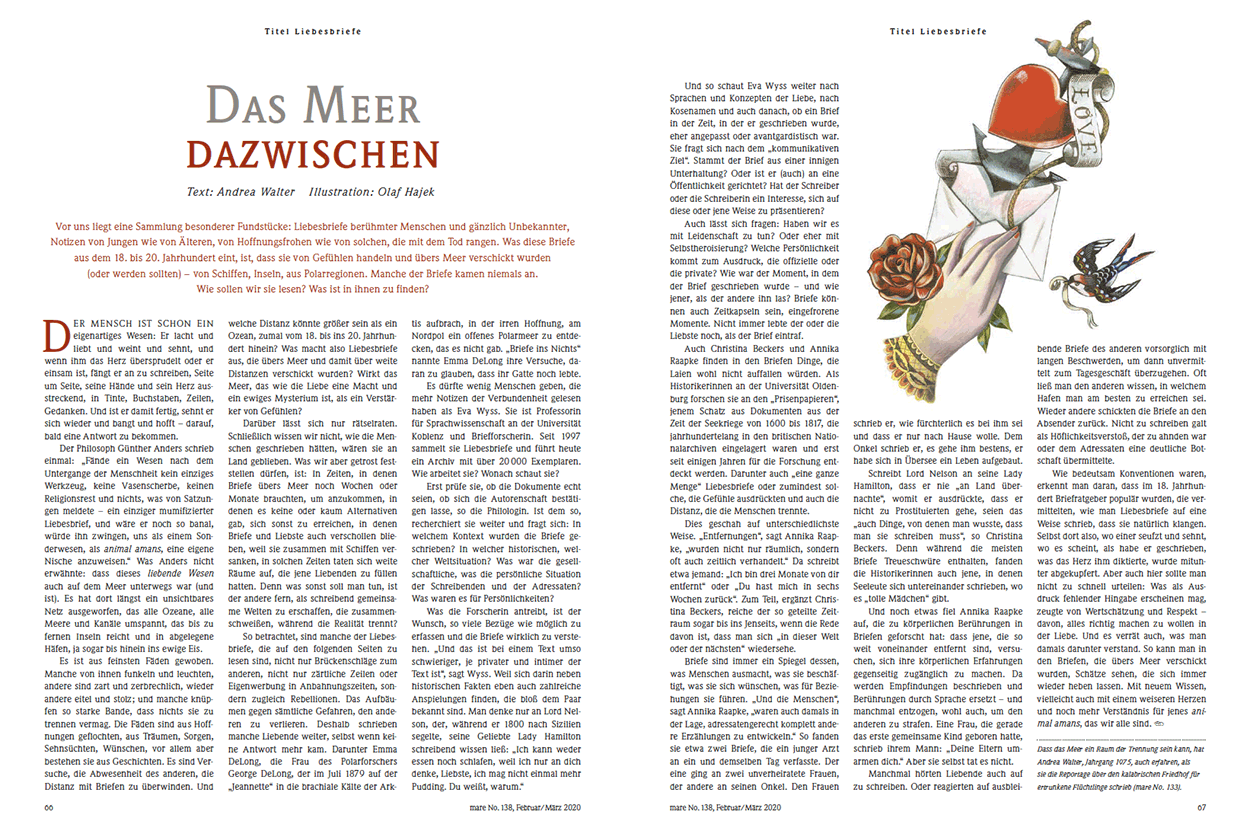Das Meer dazwischen
Der Mensch ist schon ein eigenartiges Wesen: Er lacht und liebt und weint und sehnt, und wenn ihm das Herz übersprudelt oder er einsam ist, fängt er an zu schreiben, Seite um Seite, seine Hände und sein Herz ausstreckend, in Tinte, Buchstaben, Zeilen, Gedanken. Und ist er damit fertig, sehnt er sich wieder und bangt und hofft – darauf, bald eine Antwort zu bekommen.
Der Philosoph Günther Anders schrieb einmal: „Fände ein Wesen nach dem Untergange der Menschheit kein einziges Werkzeug, keine Vasenscherbe, keinen Religionsrest und nichts, was von Satzungen meldete – ein einziger mumifizierter Liebesbrief, und wäre er noch so banal, würde ihn zwingen, uns als einem Sonderwesen, als animal amans, eine eigene Nische anzuweisen.“ Was Anders nicht erwähnte: dass dieses liebende Wesen auch auf dem Meer unterwegs war (und ist). Es hat dort längst ein unsichtbares Netz ausgeworfen, das alle Ozeane, alle Meere und Kanäle umspannt, das bis zu fernen Inseln reicht und in abgelegene Häfen, ja sogar bis hinein ins ewige Eis.
Es ist aus feinsten Fäden gewoben. Manche von ihnen funkeln und leuchten, andere sind zart und zerbrechlich, wieder andere eitel und stolz; und manche knüpfen so starke Bande, dass nichts sie zu trennen vermag. Die Fäden sind aus Hoffnungen geflochten, aus Träumen, Sorgen, Sehnsüchten, Wünschen, vor allem aber bestehen sie aus Geschichten. Es sind Versuche, die Abwesenheit des anderen, die Distanz mit Briefen zu überwinden. Und welche Distanz könnte größer sein als ein Ozean, zumal vom 18. bis ins 20. Jahrhundert hinein? Was macht also Liebesbriefe aus, die übers Meer und damit über weite Distanzen verschickt wurden? Wirkt das Meer, das wie die Liebe eine Macht und ein ewiges Mysterium ist, als ein Verstärker von Gefühlen?
Darüber lässt sich nur rätselraten. Schließlich wissen wir nicht, wie die Menschen geschrieben hätten, wären sie an Land geblieben. Was wir aber getrost feststellen dürfen, ist: In Zeiten, in denen Briefe übers Meer noch Wochen oder Monate brauchten, um anzukommen, in denen es keine oder kaum Alternativen gab, sich sonst zu erreichen, in denen Briefe und Liebste auch verschollen blieben, weil sie zusammen mit Schiffen versanken, in solchen Zeiten taten sich weite Räume auf, die jene Liebenden zu füllen hatten. Denn was sonst soll man tun, ist der andere fern, als schreibend gemeinsame Welten zu erschaffen, die zusammenschweißen, während die Realität trennt?
So betrachtet, sind manche der Liebesbriefe, die auf den folgenden Seiten zu lesen sind, nicht nur Brückenschläge zum anderen, nicht nur zärtliche Zeilen oder Eigenwerbung in Anbahnungszeiten, sondern zugleich Rebellionen. Das Aufbäumen gegen sämtliche Gefahren, den anderen zu verlieren. Deshalb schrieben manche Liebende weiter, selbst wenn keine Antwort mehr kam. Darunter Emma DeLong, die Frau des Polarforschers George DeLong, der im Juli 1879 auf der „Jeannette“ in die brachiale Kälte der Arktis aufbrach, in der irren Hoffnung, am Nordpol ein offenes Polarmeer zu entdecken, das es nicht gab. „Briefe ins Nichts“ nannte Emma DeLong ihre Versuche, da- ran zu glauben, dass ihr Gatte noch lebte.
Es dürfte wenig Menschen geben, die mehr Notizen der Verbundenheit gelesen haben als Eva Wyss. Sie ist Professorin für Sprachwissenschaft an der Universität Koblenz und Briefforscherin. Seit 1997 sammelt sie Liebesbriefe und führt heute ein Archiv mit über 20 000 Exemplaren. Wie arbeitet sie? Wonach schaut sie?
Erst prüfe sie, ob die Dokumente echt seien, ob sich die Autorenschaft bestätigen lasse, so die Philologin. Ist dem so, recherchiert sie weiter und fragt sich: In welchem Kontext wurden die Briefe ge- schrieben? In welcher historischen, welcher Weltsituation? Was war die gesellschaftliche, was die persönliche Situation der Schreibenden und der Adressaten? Was waren es für Persönlichkeiten?
Was die Forscherin antreibt, ist der Wunsch, so viele Bezüge wie möglich zu erfassen und die Briefe wirklich zu verstehen. „Und das ist bei einem Text umso schwieriger, je privater und intimer der Text ist“, sagt Wyss. Weil sich darin neben historischen Fakten eben auch zahlreiche Anspielungen finden, die bloß dem Paar bekannt sind. Man denke nur an Lord Nelson, der, während er 1800 nach Sizilien segelte, seine Geliebte Lady Hamilton schreibend wissen ließ: „Ich kann weder essen noch schlafen, weil ich nur an dich denke, Liebste, ich mag nicht einmal mehr Pudding. Du weißt, warum.“
Und so schaut Eva Wyss weiter nach Sprachen und Konzepten der Liebe, nach Kosenamen und auch danach, ob ein Brief in der Zeit, in der er geschrieben wurde, eher angepasst oder avantgardistisch war. Sie fragt sich nach dem „kommunikativen Ziel“. Stammt der Brief aus einer innigen Unterhaltung? Oder ist er (auch) an eine Öffentlichkeit gerichtet? Hat der Schreiber oder die Schreiberin ein Interesse, sich auf diese oder jene Weise zu präsentieren?
Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 138. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.
Dass das Meer ein Raum der Trennung sein kann, hat Andrea Walter, Jahrgang 1975, auch erfahren, als sie die Reportage über den kalabrischen Friedhof für ertrunkene Flüchtlinge schrieb (mare No. 133).
| Vita | Dass das Meer ein Raum der Trennung sein kann, hat Andrea Walter, Jahrgang 1975, auch erfahren, als sie die Reportage über den kalabrischen Friedhof für ertrunkene Flüchtlinge schrieb (mare No. 133). |
|---|---|
| Person | Von Andrea Walter |
| Vita | Dass das Meer ein Raum der Trennung sein kann, hat Andrea Walter, Jahrgang 1975, auch erfahren, als sie die Reportage über den kalabrischen Friedhof für ertrunkene Flüchtlinge schrieb (mare No. 133). |
| Person | Von Andrea Walter |