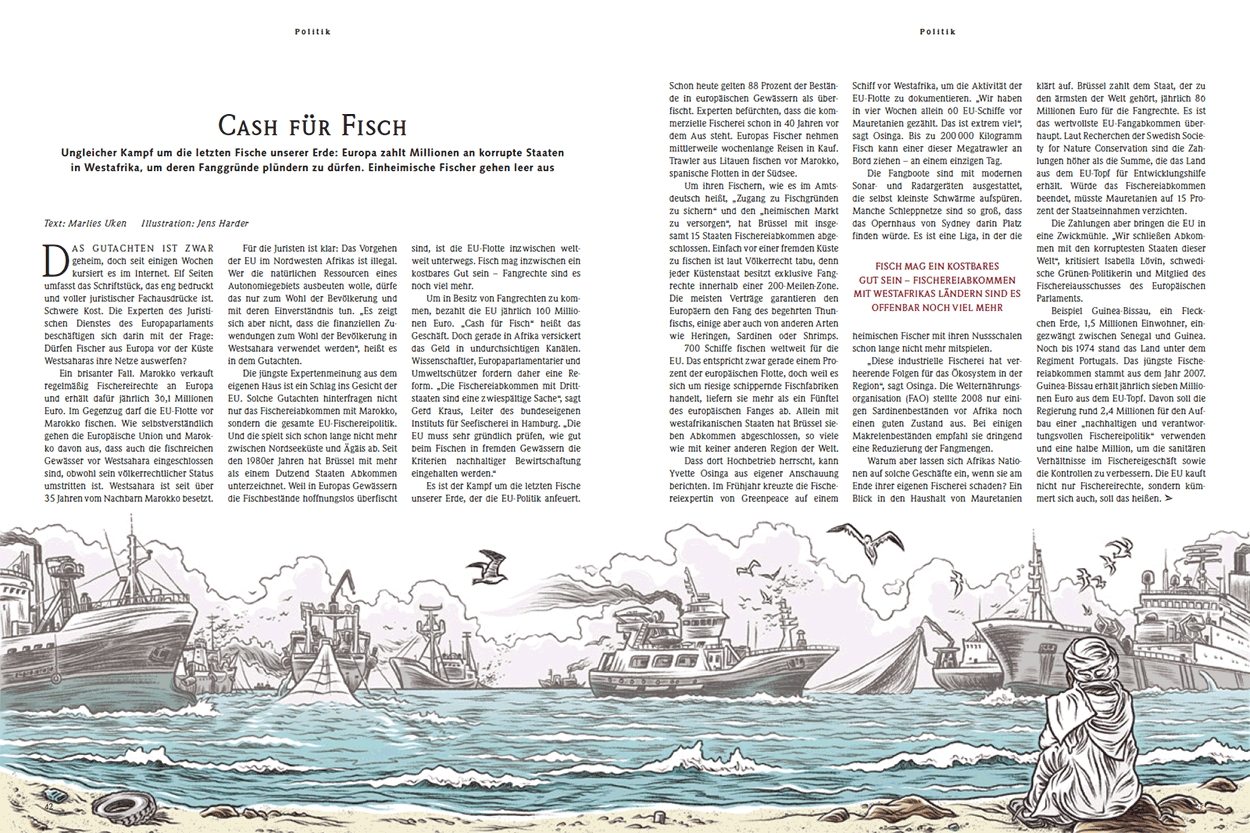Cash für Fisch
Das Gutachten ist zwargeheim, doch seit einigen Wochen kursiert es im Internet. Elf Seiten umfasst das Schriftstück, das eng bedruckt und voller juristischer Fachausdrücke ist. Schwere Kost. Die Experten des Juristischen Dienstes des Europaparlaments beschäftigen sich darin mit der Frage: Dürfen Fischer aus Europa vor der Küste Westsaharas ihre Netze auswerfen?
Ein brisanter Fall. Marokko verkauft regelmäßig Fischereirechte an Europa und erhält dafür jährlich 36,1 Millionen Euro. Im Gegenzug darf die EU-Flotte vor Marokko fischen. Wie selbstverständlich gehen die Europäische Union und Marokko davon aus, dass auch die fischreichen Gewässer vor Westsahara eingeschlossen sind, obwohl sein völkerrechtlicher Statusumstritten ist. Westsahara ist seit über 35 Jahren vom Nachbarn Marokko besetzt.
Für die Juristen ist klar: Das Vorgehen der EU im Nordwesten Afrikas ist illegal. Wer die natürlichen Ressourcen eines Autonomiegebiets ausbeuten wolle, dürfe das nur zum Wohl der Bevölkerung und mit deren Einverständnis tun. „Es zeigt sich aber nicht, dass die finanziellen Zuwendungen zum Wohl der Bevölkerung in Westsahara verwendet werden“, heißt es in dem Gutachten.
Die jüngste Expertenmeinung aus dem eigenen Haus ist ein Schlag ins Gesicht der EU. Solche Gutachten hinterfragen nicht nur das Fischereiabkommen mit Marokko, sondern die gesamte EU-Fischereipolitik. Und die spielt sich schon lange nicht mehr zwischen Nordseeküste und Ägäis ab. Seit den 1980er Jahren hat Brüssel mit mehr als einem Dutzend Staaten Abkommen unterzeichnet. Weil in Europas Gewässern die Fischbestände hoffnungslos überfischt sind, ist die EU-Flotte inzwischen weltweit unterwegs. Fisch mag inzwischen ein kostbares Gut sein – Fangrechte sind es noch viel mehr.
Um in Besitz von Fangrechten zu kommen, bezahlt die EU jährlich 160 Millionen Euro. „Cash für Fisch“ heißt das Geschäft. Doch gerade in Afrika versickert das Geld in undurchsichtigen Kanälen. Wissenschaftler, Europaparlamentarier und Umweltschützer fordern daher eine Reform. „Die Fischereiabkommen mit Drittstaaten sind eine zwiespältige Sache“, sagt Gerd Kraus, Leiter des bundeseigenen Instituts für Seefischerei in Hamburg. „Die EU muss sehr gründlich prüfen, wie gut beim Fischen in fremden Gewässern die Kriterien nachhaltiger Bewirtschaftung eingehalten werden.“
Es ist der Kampf um die letzten Fische unserer Erde, der die EU-Politik anfeuert. Schon heute gelten 88 Prozent der Bestände in europäischen Gewässern als überfischt. Experten befürchten, dass die kommerzielle Fischerei schon in 40 Jahren vor dem Aus steht. Europas Fischer nehmen mittlerweile wochenlange Reisen in Kauf. Trawler aus Litauen fischen vor Marokko, spanische Flotten in der Südsee.
Um ihren Fischern, wie es im Amtsdeutsch heißt, „Zugang zu Fischgründen zu sichern“ und den „heimischen Markt zu versorgen“, hat Brüssel mit insgesamt 15 Staaten Fischereiabkommen abgeschlossen. Einfach vor einer fremden Küste zu fischen ist laut Völkerrecht tabu, denn jeder Küstenstaat besitzt exklusive Fangrechte innerhalb einer 200-Meilen-Zone. Die meisten Verträge garantieren den Europäern den Fang des begehrten Thunfischs, einige aber auch von anderen Arten wie Heringen, Sardinen oder Shrimps. 700 Schiffe fischen weltweit für die EU. Das entspricht zwar gerade einem Prozent der europäischen Flotte, doch weil es sich um riesige schippernde Fischfabriken handelt, liefern sie mehr als ein Fünftel des europäischen Fanges ab. Allein mit westafrikanischen Staaten hat Brüssel sieben Abkommen abgeschlossen, so viele wie mit keiner anderen Region der Welt.
Dass dort Hochbetrieb herrscht, kann Yvette Osinga aus eigener Anschauung berichten. Im Frühjahr kreuzte die Fischereiexpertin von Greenpeace auf einem Schiff vor Westafrika, um die Aktivität der EU-Flotte zu dokumentieren. „Wir haben in vier Wochen allein 60 EU-Schiffe vor Mauretanien gezählt. Das ist extrem viel“, sagt Osinga. Bis zu 200 000 Kilogramm Fisch kann einer dieser Megatrawler an Bord ziehen – an einem einzigen Tag.
Die Fangboote sind mit modernen Sonar- und Radargeräten ausgestattet, die selbst kleinste Schwärme aufspüren. Manche Schleppnetze sind so groß, dass das Opernhaus von Sydney darin Platz finden würde. Es ist eine Liga, in der die heimischen Fischer mit ihren Nussschalen schon lange nicht mehr mitspielen.
„Diese industrielle Fischerei hat verheerende Folgen für das Ökosystem in der Region“, sagt Osinga. Die Welternährungsorganisation (FAO) stellte 2008 nur einigen Sardinenbeständen vor Afrika noch einen guten Zustand aus. Bei einigen Makrelenbeständen empfahl sie dringend eine Reduzierung der Fangmengen.
Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 81. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.
Besonders ergiebig fand die Berliner Autorin Marlies Uken, Jahrgang 1977, ihr Gespräch mit Franz Fischler. Der Ex-EU-Kommissar erzählte ohne Umschweife von den vertrackten Verhandlungen mit afrikanischen Staaten.
Illustrator Jens Harder, Jahrgang 1970, aus Berlin, findet es unappetitlich, Fische zu Stäbchen zu verpressen – ob nach EU-Regeln oder nicht.
| Vita | Besonders ergiebig fand die Berliner Autorin Marlies Uken, Jahrgang 1977, ihr Gespräch mit Franz Fischler. Der Ex-EU-Kommissar erzählte ohne Umschweife von den vertrackten Verhandlungen mit afrikanischen Staaten.
Illustrator Jens Harder, Jahrgang 1970, aus Berlin, findet es unappetitlich, Fische zu Stäbchen zu verpressen – ob nach EU-Regeln oder nicht. |
|---|---|
| Person | Von Marlies Uken und Jens Harder |
| Vita | Besonders ergiebig fand die Berliner Autorin Marlies Uken, Jahrgang 1977, ihr Gespräch mit Franz Fischler. Der Ex-EU-Kommissar erzählte ohne Umschweife von den vertrackten Verhandlungen mit afrikanischen Staaten.
Illustrator Jens Harder, Jahrgang 1970, aus Berlin, findet es unappetitlich, Fische zu Stäbchen zu verpressen – ob nach EU-Regeln oder nicht. |
| Person | Von Marlies Uken und Jens Harder |