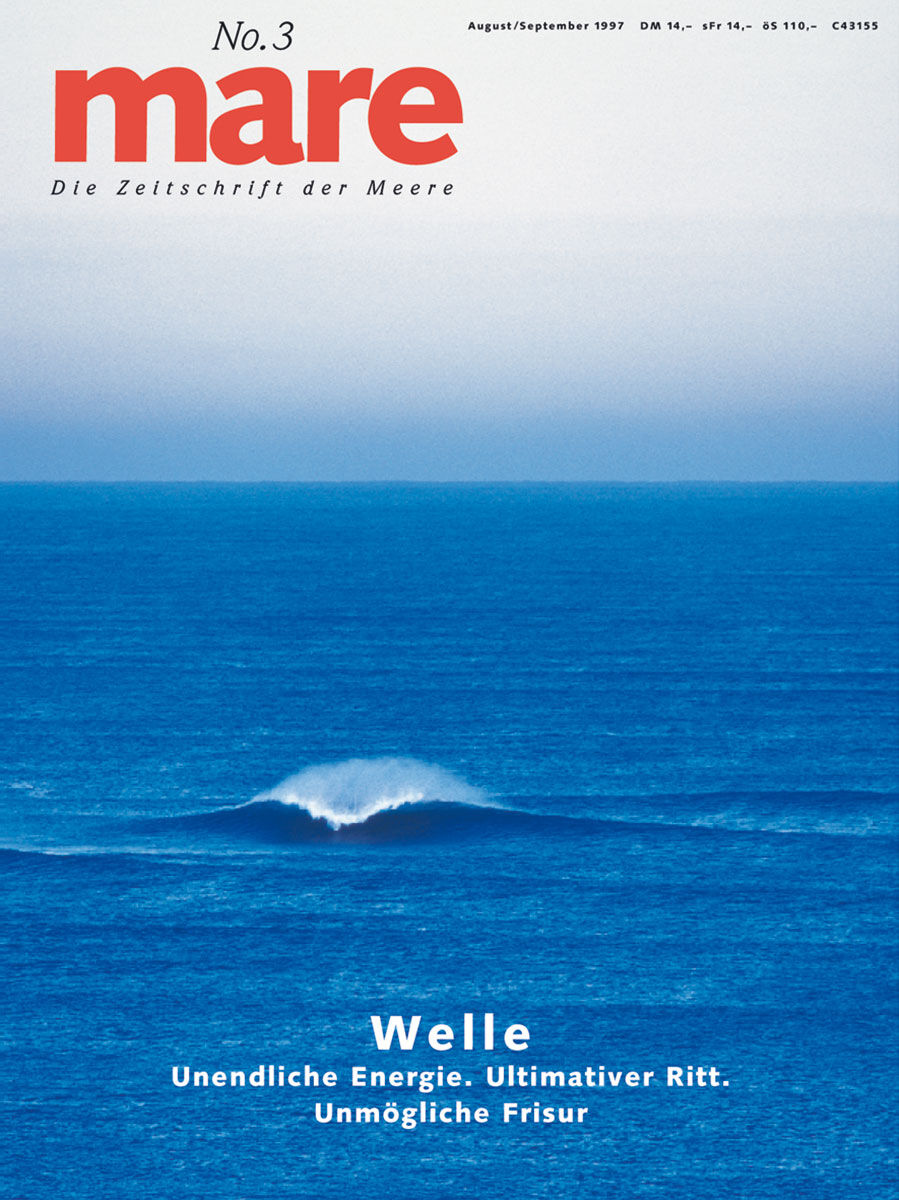Nirwana der Wellenreiter
Ole faitotoa leneiilelagi – „Der Weg in den Himmel“ verheißen türkise Lettern an der weißen Methodistenkirche von Maninoa. Für Surfer auf der samoanischen Insel Upolu kein weiter Weg. Nur wenige hundert Meter jenseits der Dorfkirche führt, vorbei an Hibiskushecken, Kokospalmen und Mangroven, der Weg zur Lagune. Auch wenn dort noch nicht das himmlische Paradies beginnt, so hallt es doch wider. In jeder Welle draußen am Riff ist für Surfer das kosmische Seufzen eines Sternes allgegenwärtig. Das Licht der Sonne hat den Wind geschaffen und der Wind die Wellen. Am Riff, wo eine Millionen Meilen lange Reise zu Ende geht, entlädt sich explosionsartig die Energie, die aus dem Himmel kommt. In einer kraftvollen Woge, ebenmäßig zum Oval geformt. Strider, der ewig Barfüßige in den knielangen Bermudas, Strider, das menschliche Amphibium, grient. Von der Bar des Coconuts Resort schaut er aufs Meer. Drüben am Riff hatte er vor einer Woche den Take off auf einer röhrenden Zehn-Fuß-Welle gewagt. Als erster von vier Profisurfern auf Wellensuche, die zu den versiertesten der Welt gehören. Danach durfte der Kalifornier den neuentdeckten Spot taufen – auf den Namen „Catapult“. Seinen Lieblingscocktail. Doch Striders Augen lächeln kaum. Als verberge sich Wehmut unter seinen sonnengebleichten Brauen.
„Aitu“ nennen die Einheimischen jenen unsichtbaren Geist, der hier für „good vibrations“ sorgt. Der Ort, wo ein Aussteigerpärchen aus Berverly Hills das Coconuts Resort errichtete. Treffpunkt für eine Weltpremiere. Vier Berufssurfer und drei surfende Rockmusiker aus den USA suchen hier so etwas wie die Blaue Blume der Wellenreiter. Ein jobübergreifendes Projekt, das Surffotograf Aaron Chang mit eigenem Brett und wasserdichter Kamera begleitet. Auf ihren Fiberglasplanken wollen sie alle das sagenhafte „Greenhouse“ durchqueren – den grünen Kristallpalast aus Wasser. Das Nirwana, im Surferslang. Die perfekte Welle. Sie zeigt sich an ausgewählten Orten wie diesem. Nur wann ist die Frage.
Ungeduldig taxiert Leadsänger Perry Farrell durch seine „schnelle“ Sonnenbrille die morgendliche Gischt vor der Schildkrötenbucht. Perry ist keine launische Rock-Diva, aber was er sieht, könnte besser sein. 8000 Kilometer weit ist er von Los Angeles eingeschwebt, mehrere Surfboards im Gepäck. Der hellwache Grimassenschneider kommentiert lautlos die Szenerie. Das dampfende Line up drüben rechts vor „Catapult“ sieht miserabel aus: Die Welle bricht auf ganzer Front – ein böses Close out – und läßt längs des Kamms keinen Raum für Surfkapriolen. Für seinen Gitarristen Peter di Stefano, durch und durch Wassernarr, weniger schlimm. Hauptsache Wasser. Auch Bandmanager Roger Leonard nimmt die Sache gelassen. „Porno for Pyros“ heißt die Band der tätowierten Surfrocker von der US-Westküste, verspielte Jünglinge im Alter zwischen 31 und 38. Kenner prophezeien den Pyro(s)manen mit Hang zum Stabreim eine große Zukunft in der nicht-kommerziellen Musikszene. Doch jetzt ist erstmal zwei Wochen lang Session in der Südsee angesagt. The rhythm of waves. Eine ungleiche Truppe hat sich da im Coconuts zusammengefunden. Musiker und Wellentänzer, die einander vor dem Abflug noch nicht kannten. Die aber eines verbindet: ihre Sehnsucht nach dem „Greenhouse“. Eine Übung in Geduld.
Heute spielt die Musik bei „T-Rex“. Ein Name, den Perry für den Spot östlich des Coconuts bevorzugt – weil man auf dem Brett übers seichte Riff wie mit kurzen Saurierärmchen rauspaddeln muss. Eine halbe Meile vom Strand entfernt, pellen sich quirlige Zweimeterwogen vor der Korallenbank. Sogenannte Lefts, linksbrechende Wellen vom Meer aus betrachtet. Perry, der hier im Coconuts einen neuen Song komponiert, wird plötzlich ein wenig philosophisch. Während seine Hand hinaus auf die Kräuselungen des Ozeans deutet, doziert er über die „Holonomic resonance“, seinen Lieblingsbegriff. „Jede positive Schwingung von uns geht nach dort draußen und wirkt fort.“ Perry und seine spirituellen Anwandlungen. Strider macht es auf seine Weise vor. Mit leicht gespreizten Beinen steht er da. „Die Meeresenergie strömt durch das Brett in den Körper. Sie bleibt hier drinnen“, Strider tippt sich gegen die nackte Brust, „und kommt auch hier raus.“ Er reißt die Arme auseinander und jauchzt. Der Surfschrei geht durch Mark und Bein. „Reinste Euphorie. Je größer die Welle, desto stärker der Effekt.“
Wie auch immer, die Vibrations dort draußen auf dem Wasser sind allemal positiv. Gut, daß das Zodiak die Gruppe so schnell aufs Riff befördert. Strider ist ganz Welle. Sein hellblonder Bürstenschnitt wächst unter einem Schaumkamm hervor, fließend erhebt sich seine Gestalt auf dem Drei-Finnen-Brett und genießt das freundliche Dröhnen der kleinen Boogiewelle. Strider nimmt alles, was er kriegen kann. Dabei lassen sich die Jungs gegenseitig den Vortritt. Wer von rechts kommt, darf zuerst. An überfüllten Massenspots eine immer wieder missachtete Vorfahrtsregel.
Und sie feuern sich an: „Go for it, Jamie!“ Sechs Jahre lang als Professional um den Erdball gesurft, bringt Jamie Brisick jetzt für ein US-Magazin seine Surfstories zu Papier – und sein Brett in die richtige Position. Jamie erlebt es zum zehntausendsten Mal. Das ungewöhnlich rasche Aufbäumen der Riffwelle, die einen schlagartig an den oberen Rand einer Wasserwand hebt. Samt Adrenalinpegel. An diesem Punkt, wenn von rechts unaufhaltsam das große Strudelauge heranwirbelt, faucht die Welle nur noch eine Botschaft: hinein und hinunter! Drop in. In Sekundenbruchteilen springt Jamie auf die Füße, gewinnt ein bedrohtes Gleichgewicht. Er steht. Und schon die erste scharfe Linkskurve. Schaum spritzt, Jamie kerbt tiefe Spuren ins Wasser. Doch die Werke eines Wellenreiters sind vergänglich. „Unsere Schöpfungen lösen sich vollkommen auf“, sinnierte erst kürzlich der Surf-Essayist Jamie Brisick. Die anderen blicken Jamie hinterher. Immer wieder das tanzende Auf und Ab von seinem Goldschopf jenseits des Wellenrückens. Ein anerkennendes Grinsen fliegt von Gesicht zu Gesicht – Aaron, Roger, Peter, Strider. Kein Neid, keine Konkurrenz.
Das ist keineswegs normal. Denn wenn sich in Südkalifornien von Malibu über Huntington Pier bis Blacks Beach Hunderttausende mit Brettern bewaffnet in die Fluten stürzen, beginnt ums spärliche Wellengut der Kampf der Platzhirsche. Zornige Locals, häufig eine Spezies aquatischer Schrebergärtner mit breitem Kreuz und schlohweißen Frisuren, schüchtern durch Imponiergehabe den Mob ein. Und der Mob, das sind immer die anderen. Inmitten von Millionen Duplikaten unendlich cool, braun und einsam – auch nach Jahrzehnten hält sich das idealtypische Image vom artistischen Wellenschönling. In wachsender Auflage heizt die Reklame in Surferjournalen die Konkurrenzgefühle mit an. Es geht um die wendigsten Bretter, die verrücktesten Trickmanöver, die mächtigsten Wellen. Und natürlich die schärfsten Frauen. Der dreifache Weltmeister Kelly Slater (24), drogenabstinente und millionenschwere Vorzeigefigur der Surfindustrie, ähnelt einer Mischung aus Sexsymbol Elvis Presley und Saubermann Tom Cruise. Ein Typ, so „gelenkig, dass er sogar den eigenen Hintern küssen kann“, wie ein Teamkollege sagt. Kelly, der gnadenlos talentierte, liebe Kerl von nebenan, hat nur einen wirklich schweren Fehler, so wird aus seinem Freundeskreis kolportiert: Er ist vom Konkurrenzdenken besessen. Kelly muss stets der Beste sein.
Von Rivalität ist hier im sanften Gewoge vor der Schildkrötenbucht nichts zu spüren. Als wären die gemilderten Tropen Samoas, wo weder Giftschlangen noch Malaria die Menschen heimsuchen, eigens für dieses Happening geschaffen: Rockmusiker und Surf-Profis Seite an Seite in der Meeresschaukel. Während des Spähens nach schwellenden Wellenrücken wendet sich der Blick von Zeit zu Zeit rückwärts zur Küste. Die mit Palmwipfeln gesprenkelten Regenwaldberge des Le-Pupu-Pue-Nationalparks wachsen direkt in die leuchtenden Wolken. Kokospalmen allerorten – eines der Überbleibsel aus kaiserlich-deutscher Kolonialzeit vor dem Ersten Weltkrieg. Die Deutschen veranlaßten seinerzeit die Pflanzung unzähliger Kokospalmen.
Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 3. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.
Thomas Worm, Jahrgang 1957, lebt als freier Autor in Berlin und schreibt Reisereportagen.
Aaron Chang, Jahrgang 1956, Natur- und Surf-Fotograf, lebt in Kalifornien. Er arbeitet sowohl für Magazine und Zeitschriften als auch für Kunden wie Apple, Levi's, Macy's, Nike, Yamaha und Polaris.
| Vita | Thomas Worm, Jahrgang 1957, lebt als freier Autor in Berlin und schreibt Reisereportagen.
Aaron Chang, Jahrgang 1956, Natur- und Surf-Fotograf, lebt in Kalifornien. Er arbeitet sowohl für Magazine und Zeitschriften als auch für Kunden wie Apple, Levi's, Macy's, Nike, Yamaha und Polaris. |
|---|---|
| Person | Von Thomas Worm und Aaron Chang |
| Vita | Thomas Worm, Jahrgang 1957, lebt als freier Autor in Berlin und schreibt Reisereportagen.
Aaron Chang, Jahrgang 1956, Natur- und Surf-Fotograf, lebt in Kalifornien. Er arbeitet sowohl für Magazine und Zeitschriften als auch für Kunden wie Apple, Levi's, Macy's, Nike, Yamaha und Polaris. |
| Person | Von Thomas Worm und Aaron Chang |