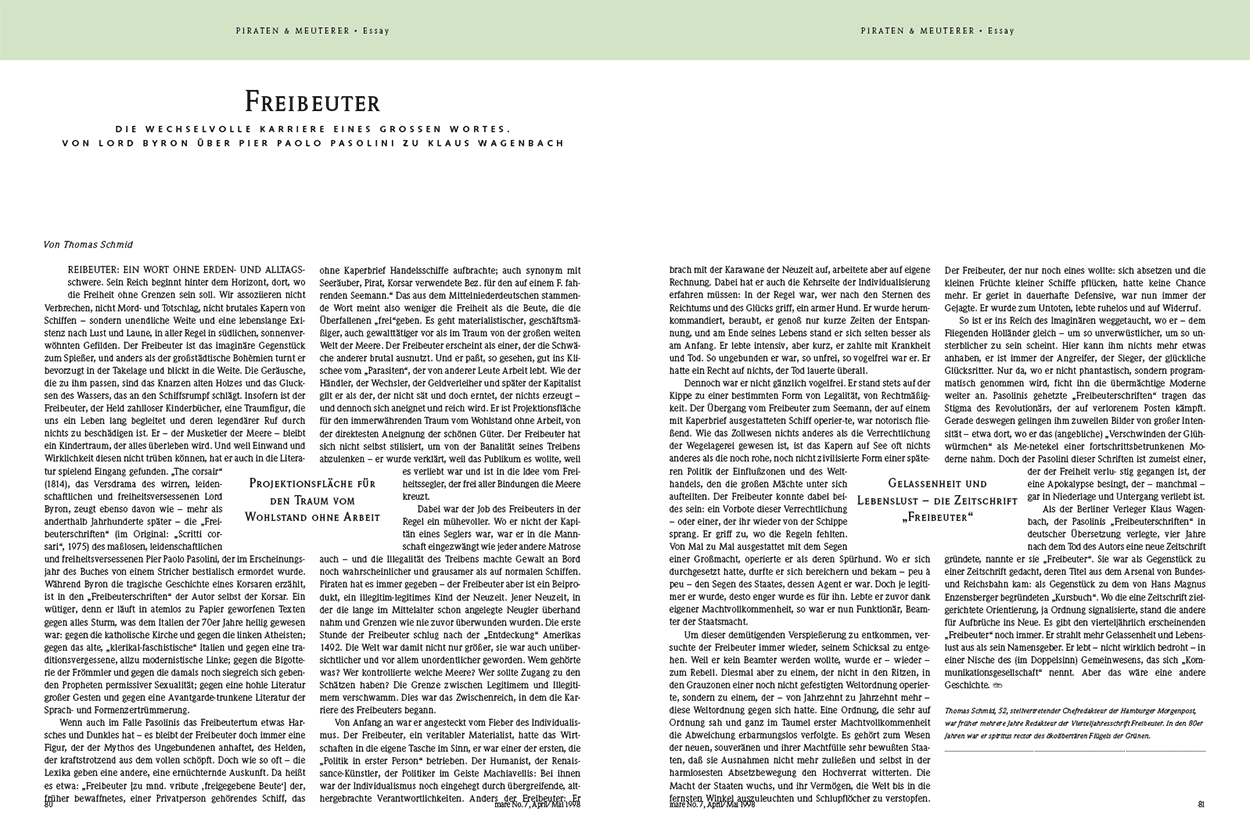Freibeuter
Freibeuter: ein Wort ohne Erden- und Alltagsschwere. Sein Reich beginnt hinter dem Horizont, dort, wo die Freiheit ohne Grenzen sein soll. Wir assoziieren nicht Verbrechen, nicht Mord- und Totschlag, nicht brutales Kapern von Schiffen – sondern unendliche Weite und eine lebenslange Existenz nach Lust und Laune, in aller Regel in südlichen, sonnenverwöhnten Gefilden. Der Freibeuter ist das imaginäre Gegenstück zum Spießer, und anders als der großstädtische Bohèmien turnt er bevorzugt in der Takelage und blickt in die Weite. Die Geräusche, die zu ihm passen, sind das Knarzen alten Holzes und das Glucksen des Wassers, das an den Schiffsrumpf schlägt. Insofern ist der Freibeuter, der Held zahlloser Kinderbücher, eine Traumfigur, die uns ein Leben lang begleitet und deren legendärer Ruf durch nichts zu beschädigen ist. Er – der Musketier der Meere – bleibt ein Kindertraum, der alles überleben wird.
Und weil Einwand und Wirklichkeit diesen nicht trüben können, hat er auch in die Literatur spielend Eingang gefunden. „The corsair“ (1814), das Versdrama des wirren, leidenschaftlichen und freiheitsversessenen Lord Byron, zeugt ebenso davon wie – mehr als anderthalb Jahrhunderte später – die „Freibeuterschriften“ (im Original: „Scritti corsari“, 1975) des maßlosen, leidenschaftlichen und freiheitsversessenen Pier Paolo Pasolini, der im Erscheinungsjahr des Buches von einem Stricher bestialisch ermordet wurde. Während Byron die tragische Geschichte eines Korsaren erzählt, ist in den „Freibeuterschriften“ der Autor selbst der Korsar. Ein wütiger, denn er läuft in atemlos zu Papier geworfenen Texten gegen alles Sturm, was dem Italien der 70er Jahre heilig gewesen war: gegen die katholische Kirche und gegen die linken Atheisten; gegen das alte, „klerikal-faschistische“ Italien und gegen eine traditionsvergessene, allzu modernistische Linke; gegen die Bigotterie der Frömmler und gegen die damals noch siegreich sich gebenden Propheten permissiver Sexualität; gegen eine hohle Literatur großer Gesten und gegen eine Avantgarde-trunkene Literatur der Sprach- und Formenzertrümmerung.
Wenn auch im Falle Pasolinis das Freibeutertum etwas Harsches und Dunkles hat – es bleibt der Freibeuter doch immer eine Figur, der der Mythos des Ungebundenen anhaftet, des Helden, der kraftstrotzend aus dem vollen schöpft. Doch wie so oft – die Lexika geben eine andere, eine ernüchternde Auskunft. Da heißt es etwa: „Freibeuter [zu mnd. vribute ’freigegebene Beute‘] der, früher bewaffnetes, einer Privatperson gehörendes Schiff, das ohne Kaperbrief Handelsschiffe aufbrachte; auch synonym mit Seeräuber, Pirat, Korsar verwendete Bez. für den auf einem F. fahrenden Seemann.“ Das aus dem Mittelniederdeutschen stammende Wort meint also weniger die Freiheit als die Beute, die die Überfallenen „frei“geben.
Es geht materialistischer, geschäftsmäßiger, auch gewalttätiger vor als im Traum von der großen weiten Welt der Meere. Der Freibeuter erscheint als einer, der die Schwäche anderer brutal ausnutzt. Und er passt, so gesehen, gut ins Klischee vom „Parasiten“, der von anderer Leute Arbeit lebt. Wie der Händler, der Wechsler, der Geldverleiher und später der Kapitalist gilt er als der, der nicht sät und doch erntet, der nichts erzeugt – und dennoch sich aneignet und reich wird. Er ist Projektionsfläche für den immerwährenden Traum vom Wohlstand ohne Arbeit, von der direktesten Aneignung der schönen Güter. Der Freibeuter hat sich nicht selbst stilisiert, um von der Banalität seines Treibens abzulenken – er wurde verklärt, weil das Publikum es wollte, weil es verliebt war und ist in die Idee vom Freiheitssegler, der frei aller Bindungen die Meere kreuzt.
Dabei war der Job des Freibeuters in der Regel ein mühevoller. Wo er nicht der Kapitän eines Seglers war, war er in die Mannschaft eingezwängt wie jeder andere Matrose auch – und die Illegalität des Treibens machte Gewalt an Bord noch wahrscheinlicher und grausamer als auf normalen Schiffen. Piraten hat es immer gegeben – der Freibeuter aber ist ein Beiprodukt, ein illegitim-legitimes Kind der Neuzeit. Jener Neuzeit, in der die lange im Mittelalter schon angelegte Neugier überhand nahm und Grenzen wie nie zuvor überwunden wurden. Die erste Stunde der Freibeuter schlug nach der „Entdeckung“ Amerikas 1492. Die Welt war damit nicht nur größer, sie war auch unübersichtlicher und vor allem unordentlicher geworden. Wem gehörte was? Wer kontrollierte welche Meere? Wer sollte Zugang zu den Schätzen haben? Die Grenze zwischen Legitimem und Illegitimem verschwamm. Dies war das Zwischenreich, in dem die Karriere des Freibeuters begann.
Von Anfang an war er angesteckt vom Fieber des Individualismus. Der Freibeuter, ein veritabler Materialist, hatte das Wirtschaften in die eigene Tasche im Sinn, er war einer der ersten, die „Politik in erster Person“ betrieben. Der Humanist, der Renaissance-Künstler, der Politiker im Geiste Machiavellis: Bei ihnen war der Individualismus noch eingehegt durch übergreifende, althergebrachte Verantwortlichkeiten. Anders der Freibeuter: Er brach mit der Karawane der Neuzeit auf, arbeitete aber auf eigene Rechnung. Dabei hat er auch die Kehrseite der Individualisierung erfahren müssen: In der Regel war, wer nach den Sternen des Reichtums und des Glücks griff, ein armer Hund. Er wurde herumkommandiert, beraubt, er genoß nur kurze Zeiten der Entspannung, und am Ende seines Lebens stand er sich selten besser als am Anfang. Er lebte intensiv, aber kurz, er zahlte mit Krankheit und Tod. So ungebunden er war, so unfrei, so vogelfrei war er. Er hatte ein Recht auf nichts, der Tod lauerte überall.
Dennoch war er nicht gänzlich vogelfrei. Er stand stets auf der Kippe zu einer bestimmten Form von Legalität, von Rechtmäßigkeit. Der Übergang vom Freibeuter zum Seemann, der auf einem mit Kaperbrief ausgestatteten Schiff operier-te, war notorisch fließend. Wie das Zollwesen nichts anderes als die Verrechtlichung der Wegelagerei gewesen ist, ist das Kapern auf See oft nichts anderes als die noch rohe, noch nicht zivilisierte Form einer späteren Politik der Einflußzonen und des Welthandels, den die großen Mächte unter sich aufteilten. Der Freibeuter konnte dabei beides sein: ein Vorbote dieser Verrechtlichung – oder einer, der ihr wieder von der Schippe sprang. Er griff zu, wo die Regeln fehlten. Von Mal zu Mal ausgestattet mit dem Segen einer Großmacht, operierte er als deren Spürhund. Wo er sich durchgesetzt hatte, durfte er sich bereichern und bekam – peu à peu – den Segen des Staates, dessen Agent er war. Doch je legitimer er wurde, desto enger wurde es für ihn. Lebte er zuvor dank eigener Machtvollkommenheit, so war er nun Funktionär, Beamter der Staatsmacht.
Um dieser demütigenden Verspießerung zu entkommen, versuchte der Freibeuter immer wieder, seinem Schicksal zu entgehen. Weil er kein Beamter werden wollte, wurde er – wieder – zum Rebell. Diesmal aber zu einem, der nicht in den Ritzen, in den Grauzonen einer noch nicht gefestigten Weltordnung operierte, sondern zu einem, der – von Jahrzehnt zu Jahrzehnt mehr – diese Weltordnung gegen sich hatte. Eine Ordnung, die sehr auf Ordnung sah und ganz im Taumel erster Machtvollkommenheit die Abweichung erbarmungslos verfolgte. Es gehört zum Wesen der neuen, souveränen und ihrer Machtfülle sehr bewußten Staaten, daß sie Ausnahmen nicht mehr zuließen und selbst in der harmlosesten Absetzbewegung den Hochverrat witterten. Die Macht der Staaten wuchs, und ihr Vermögen, die Welt bis in die fernsten Winkel auszuleuchten und Schlupflöcher zu verstopfen. Der Freibeuter, der nur noch eines wollte: sich absetzen und die kleinen Früchte kleiner Schiffe pflücken, hatte keine Chance mehr. Er geriet in dauerhafte Defensive, war nun immer der Gejagte. Er wurde zum Untoten, lebte ruhelos und auf Widerruf.
Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 7. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.
Thomas Schmid, 52, stellvertretender Chefredakteur der Hamburger Morgenpost, war früher mehrere Jahre Redakteur der Vierteljahresschrift Freibeuter. In den 80er Jahren war er spiritus rector des ökolibertären Flügels der Grünen.
| Vita | Thomas Schmid, 52, stellvertretender Chefredakteur der Hamburger Morgenpost, war früher mehrere Jahre Redakteur der Vierteljahresschrift Freibeuter. In den 80er Jahren war er spiritus rector des ökolibertären Flügels der Grünen. |
|---|---|
| Person | Ein Essay von Thomas Schmid |
| Vita | Thomas Schmid, 52, stellvertretender Chefredakteur der Hamburger Morgenpost, war früher mehrere Jahre Redakteur der Vierteljahresschrift Freibeuter. In den 80er Jahren war er spiritus rector des ökolibertären Flügels der Grünen. |
| Person | Ein Essay von Thomas Schmid |