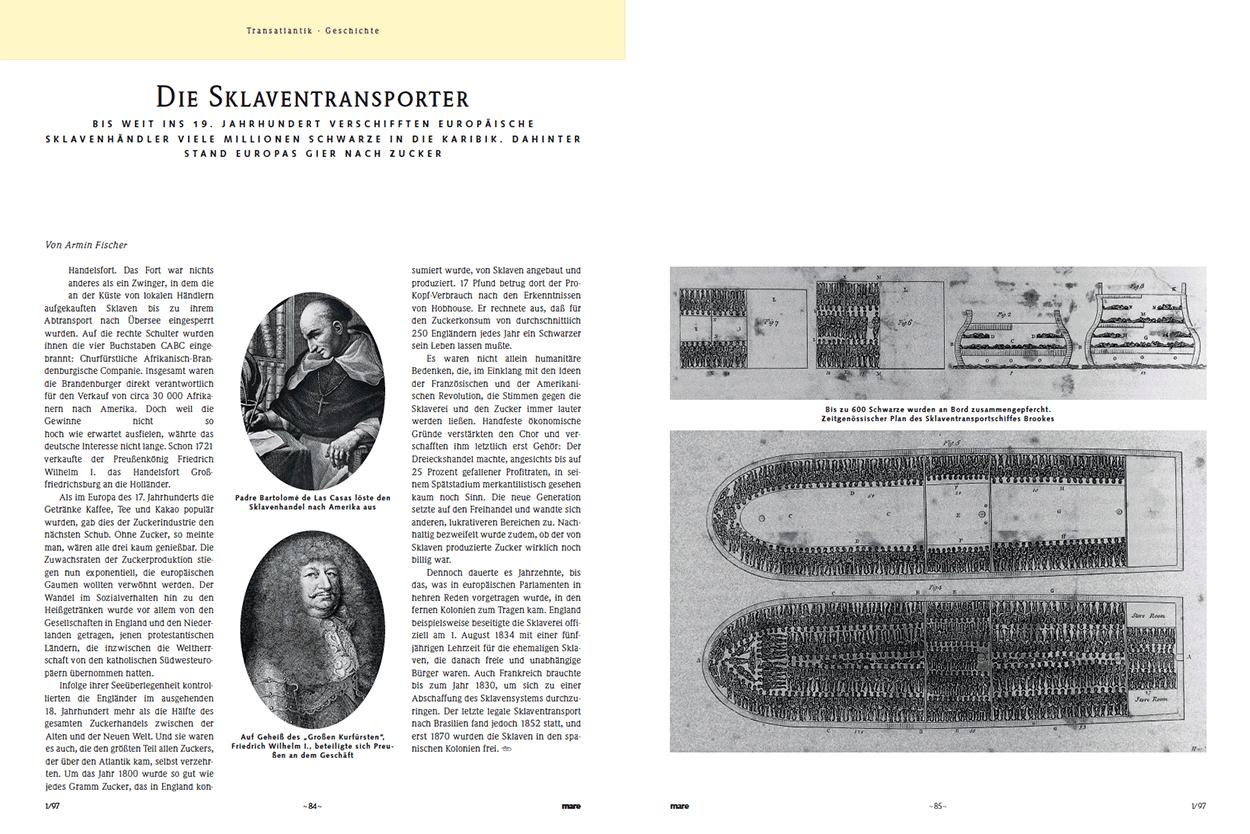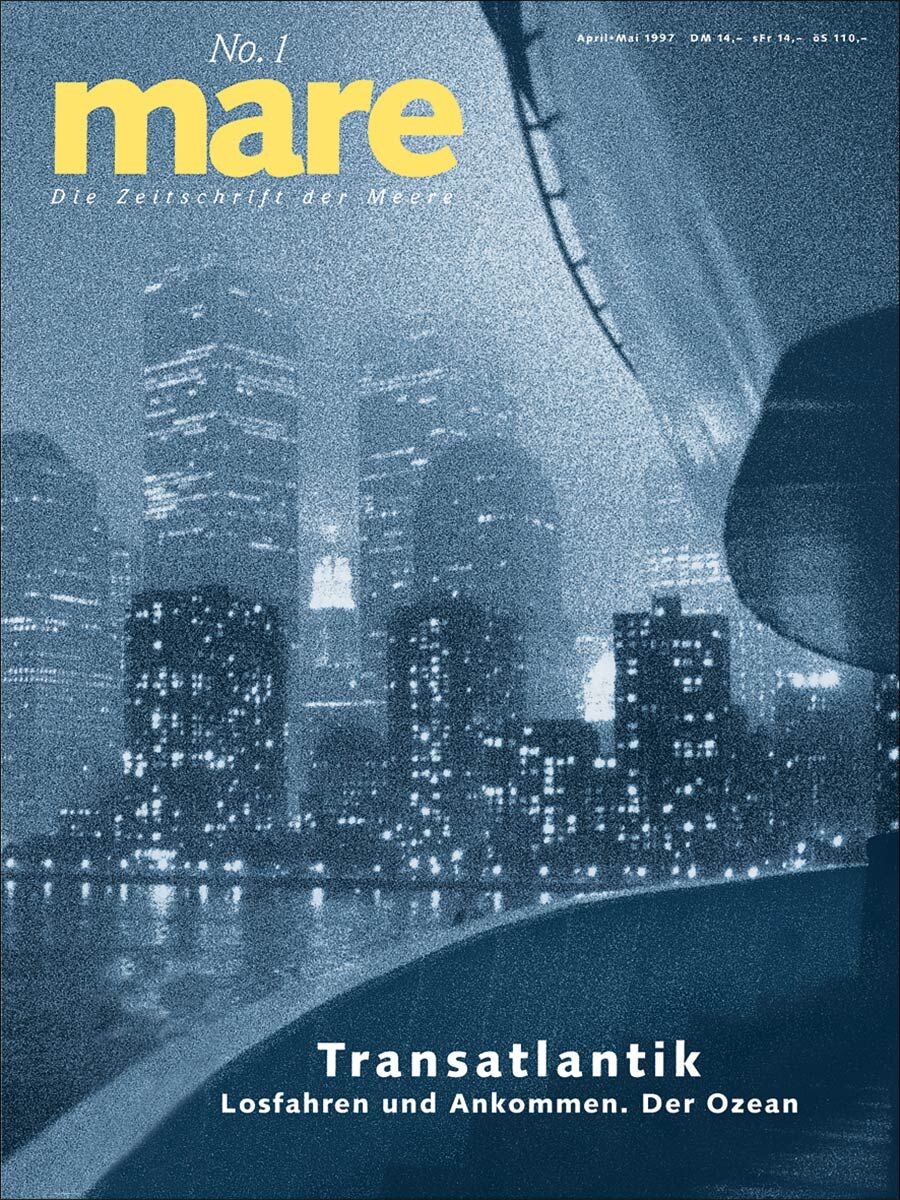Die Sklaventransporter
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts verzeichnete eine Londoner Firma, die medizinische Gerätschaften vertrieb, eine ungewöhnlich gesteigerte Nachfrage nach einem Instrument mit Namen speculum oris (Mundspiegel). Der metallene Spreizer diente Ärzten dazu, bei einem Kinnladenkrampf den Mund des Patienten gewaltsam zu öffnen – eine Brachialtherapie, die nur selten angewendet wurde. Als der Chef des seriösen Londoner Handelshauses der Sache auf den Grund ging, stieß er auf einen schmuddeligen Liverpooler Laden, in dessen Schaufenster neben Daumenschrauben, Hand- und Fußfesseln auch der Kinnspreizer lag – sämtlich Ausrüstungsgegenstände für Sklavenschiffe: Gefangenen Schwarzen, die lieber Hungers sterben wollten als geknechtet und deportiert zu werden, wurde mit dem speculum oris brutal der Mund aufgehebelt, um ihnen Nahrung einzuflößen.
Zu dieser Zeit hatte sich der Handel mit verschleppten afrikanischen Arbeitskräften – Hauptumschlagplätze waren die Karibik und Südamerika – längst zu einer regelrechten Industrie entwickelt. Dementsprechend großen Bedarf an Folter- und Knebelwerkzeugen hatten die Schergen der Sklavenhändler.
Begonnen hatte all dies gut zweieinhalb Jahrhunderte zuvor. Auslöser war ausgerechnet ein Mensch, der andere von ihrer Arbeitsfron erlösen wollte: Im Jahr 1514 wurde dem Padre Bartolomé de Las Casas ein Stück Land in der spanischen Kolonie Kuba übereignet. Zu dem Land gehörten rund 100 eingeborene Kariben, die wie Sklaven gehalten wurden und auf den Plantagen arbeiten mussten. Als Las Casas erkannte, wie sehr die Indios bei ihrer aufgezwungenen Arbeit litten und wie viele an Krankheiten und Selbstmord starben, schlug er seinem König Karl V. vor, „Negersklaven“ für die Arbeit in den Kolonien einzuführen. Sie galten als fügsame und willige Arbeiter. Der Startschuss für den transatlantischen Sklavenhandel war gefallen.
Die Kolonialherren in Südamerika und auf den Karibischen Inseln erkannten bald, wie sehr ihnen die schwarzen Sklaven bei der harten Arbeit unter der unbarmherzigen Tropensonne nützen konnten. Zumal die meisten von ihnen, die von der afrikanischen Westküste – vor allem aus Sierra Leone, von der Goldküste, aus Benin, Angola und Ghana – stammten, dank ihrer angeborenen Sichelzellenanämie gegen die überall grassierende Malaria resistent waren.
Las Casas, dem es zunächst nur um die Gleichberechtigung der Karibik-Indianer gegangen war, ahnte noch nicht, welche Lawine er lostreten sollte. Später, als er sah, was er angerichtet hatte, ging er zurück nach Spanien und startete dort eine landesweite Kampagne gegen den Sklavenhandel – ohne Erfolg. Die Sklaverei hatte ein neues Territorium gefunden und sollte es so schnell nicht wieder aufgeben.
Historisch gesehen bedeutete die Versklavung der Schwarzen durch die Europäer einen Rückschritt um 1000 Jahre. In Europa war die Sklaverei seit langem durch das System der Leibeigenschaft ersetzt. Die Leibeigenen, die zwar auch ihren Herren untertan waren, hatten dennoch Freiheiten, die für Sklaven undenkbar waren: Sie konnten ein eigenes Stück Land bewirtschaften, heiraten, ein Privatleben führen – alles natürlich in Abhängigkeit von der Großzügigkeit und Gunst des Lehnsherren. Sklaven dagegen waren einfach ein „Besitz“.
Man muß bis zur Zeit der römischen Latifundien zurückgehen, um eine ähnliche Form der Massensklaverei zu finden, wie sie ab dem 16. Jahrhundert von den „modernen“ europäischen Nationen wieder betrieben wurde. Und die Zahl der karibischen und der späteren amerikanischen Sklaven übertraf seit der Antike zum ersten Mal wieder jene zwei Millionen Arbeitssklaven, die das Römische Reich 100 nach Christus zählte.
Die moderne Sklaverei wurde zur „monströsesten Verirrung in der Geschichte des Abendlandes“, schreibt der Schriftsteller Henry Hobhouse in seinem Buch „Fünf Pflanzen verändern die Welt“. Die Zahl der Afrikaner, die im Lauf der Jahrhunderte übers Meer verschleppt wurden, ist schwer zu schätzen, sie liegt bei etwa 20 Millionen, nur etwa 15 Millionen erreichten lebend das Ziel.
Treibende Kraft für den transatlantischen Sklavenhandel war die europäische Gier nach Zucker. Auf das Konto des Zuckers – den „Schweiß der Sklaven“ – ging der Transport von schätzungsweise drei Viertel aller Sklaven, schreibt Hobhouse: 15 von 20 Millionen. Im Europa des 16. Jahrhunderts war Zucker ein mit Gold aufzuwiegendes Luxusgut. Nachdem die Türken zwischen 1520 und 1570 Zypern, Kreta, die Ägäis, Ägypten und die meisten nordafrikanischen Küstenländer besetzt und dabei den größten Teil des mediterranen Zuckergewerbes zerstört hatten, kletterten die Preise steil in die Höhe. Neue Anbaumöglichkeiten waren dringend gefragt. Kaum eine Pflanze freilich wurde damals so arbeitsintensiv gewonnen wie das Zuckerrohr. Das Pflanzen war monotone Handarbeit, die Ernte eine muskelzehrende Schinderei. Beim Auskochen der Pflanzen entstanden im Zuckerhaus Temperaturen bis zu 60 Grad Celsius.
Bereits Mitte des 15. Jahrhunderts hatten die Spanier schwarze Sklaven aus den portugiesischen Handelsstationen Westafrikas für die Arbeit in ihren eigenen Zuckerrohrplantagen eingesetzt. Jetzt setzten sie diese Praxis in der Karibik fort, die binnen weniger Jahrzehnte zum Hauptproduzenten des europäischen Zuckerhandels avancierte.
Im Jahr 1510 hatte es erst eine Handvoll Zuckerrohrplantagen auf den Karibischen Inseln gegeben. 50 Jahre später waren es Hunderte, und der Zuckerexport nach Europa begann. Mit Beginn des 17. Jahrhunderts schließlich setzte ein regelmäßiger Dreieckshandel zwischen Europa, der afrikanischen Westküste und den Karibischen Inseln ein – eine neue Dimension der Sklaverei.
Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 1. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.
Der gebürtige Münchner Armin Fischer ist Sachbuchautor und freier Journalist. Er besuchte die Münchner Journalistenschule und studierte Politik, Organisationspsychologie und Geschichte der Naturwissenschaften in Salzburg und München. Nach Reporterjahren im Ausland (Singapore, Indonesien) arbeitete er als leitender Redakteur für den Burda- und Bauer-Verlag und später als Chefredakteur des Kult-Technik-Magazins T3 im englischen Future Verlag. Heute beschäftigt er sich schwerpunktmäßig mit Wissenschaftsthemen und gehörte auch zu den mare-Autoren der ersten Stunde. Daneben übersetzte er Werke von F. Scott Fitzgerald, H. G. Wells und Virginia Woolf ins Deutsche.
| Vita | Der gebürtige Münchner Armin Fischer ist Sachbuchautor und freier Journalist. Er besuchte die Münchner Journalistenschule und studierte Politik, Organisationspsychologie und Geschichte der Naturwissenschaften in Salzburg und München. Nach Reporterjahren im Ausland (Singapore, Indonesien) arbeitete er als leitender Redakteur für den Burda- und Bauer-Verlag und später als Chefredakteur des Kult-Technik-Magazins T3 im englischen Future Verlag. Heute beschäftigt er sich schwerpunktmäßig mit Wissenschaftsthemen und gehörte auch zu den mare-Autoren der ersten Stunde. Daneben übersetzte er Werke von F. Scott Fitzgerald, H. G. Wells und Virginia Woolf ins Deutsche. |
|---|---|
| Person | Von Armin Fischer |
| Vita | Der gebürtige Münchner Armin Fischer ist Sachbuchautor und freier Journalist. Er besuchte die Münchner Journalistenschule und studierte Politik, Organisationspsychologie und Geschichte der Naturwissenschaften in Salzburg und München. Nach Reporterjahren im Ausland (Singapore, Indonesien) arbeitete er als leitender Redakteur für den Burda- und Bauer-Verlag und später als Chefredakteur des Kult-Technik-Magazins T3 im englischen Future Verlag. Heute beschäftigt er sich schwerpunktmäßig mit Wissenschaftsthemen und gehörte auch zu den mare-Autoren der ersten Stunde. Daneben übersetzte er Werke von F. Scott Fitzgerald, H. G. Wells und Virginia Woolf ins Deutsche. |
| Person | Von Armin Fischer |